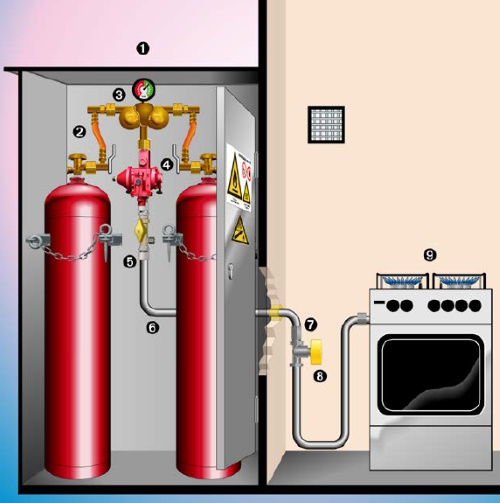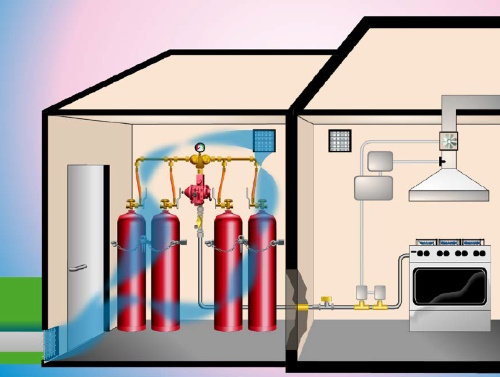5 Gefährdungen und Maßnahmen
Eigenschaften von Flüssiggas Flüssiggas hat ein besonderes Gefährdungspotenzial, da es extrem entzündbar ist und seine untere Explosionsgrenze sehr niedrig ist. Bezüglich der physikalischen Gefahren nach dem global harmonisierten System (GHS) wird Flüssiggas als extrem entzündbares Gas sowie als Gas unter Druck eingestuft, das bei Erwärmung explodieren kann. Flüssiggas ist im gasförmigen Zustand ungefähr doppelt so schwer wie Luft, kann damit zu Boden sinken und wie eine Flüssigkeit zur tiefsten Stelle fließen. Es ist farb- und geruchlos. Daher wird ihm ein Geruchsstoff zugemischt, der es im Falle einer Undichtheit an der Flüssiggasanlage ermöglicht, ausströmendes Gas anhand des Geruches möglichst schnell zu bemerken.
Der Überdruck in der Flüssiggasflasche ist von der Umgebungstemperatur abhängig (siehe Diagramm in Anhang 1). Für Propan beträgt dieser bei einer Raumtemperatur von 20 °C ca. 7,3 bar. Starkes Erwärmen der Flüssiggasflasche kann zu einem Flüssiggasaustritt aus dem Sicherheitsventil oder zum Bersten der Flüssiggasflasche führen. |
Verwendung von Flüssiggas mit unterschiedlichen Propan-/Butan-Anteilen Das Flüssiggas wird vor der Abfüllung durch eine Druckerhöhung verflüssigt und ist dadurch in jedem Druckgasbehälter (z. B. Flüssiggasflasche, siehe Abbildung 1) sowohl in der flüssigen als auch in der gasförmigen Phase vorhanden. Handelsübliches Propan nach DIN 51622 ist ein Gemisch aus mindestens 95 % Massenanteile Propan und Propen; der Propangehalt muss überwiegen. Der Rest darf aus Ethan, Ethen, Butan- und Butenisomeren bestehen. Im Handel ist es möglich, Flüssiggas mit unterschiedlichen Propan-/Butan-Anteilen zu beziehen. Hierbei ist zu beachten:
|
Füllen von Flüssiggasflaschen
Flüssiggasflaschen dürfen entsprechend TRBS 3145/TRGS 745 nur an Füllanlagen von hierzu beauftragten Beschäftigten nach § 12 BetrSichV gefüllt werden. Ein Füllen von Flüssiggasflaschen an öffentlichen Tankstellen ist verboten.
5.1 Gemeinsame Regeln für alle Flüssiggasanlagen
5.1.1 Gefahrenbereiche und Zonen
Zur Erläuterung dieser Themen sind in den nachfolgenden Abschnitten die theoretischen Grundlagen zu Gefahrenbereichen und Zoneneinteilungen beschrieben. Die praktische Umsetzung wird in 5.1.1.3 Beispielhafte Einteilung von Gefahrenbereichen und Zonen für unterschiedliche Flüssiggasanlagen und gegebenenfalls 5.1.19 Lagerung von Flüssiggasflaschen mit Hilfe von grafischen Darstellungen erläutert.
5.1.1.1 Festlegung von Gefahrenbereichen
Aufgrund der unter 5 Gefährdungen und Maßnahmen beschriebenen, besonderen Gefährdungspotenziale muss bei der Verwendung von Flüssiggas der Gefahrenbereich beurteilt und festgelegt werden. Der Gefahrenbereich im Sinne dieser DGUV Regel ist der Bereich, in dem auf Grund der örtlichen und betrieblichen Verhältnisse gefährliche Gaskonzentrationen nicht ausgeschlossen werden können, z. B. infolge betriebsbedingter Freisetzung von Flüssiggas beim Anschließen, Lösen von Rohrleitungsverbindungen sowie beim Öffnen von Peilventilen und bei störungsbedingten Gasaustritten.
Zur Vermeidung von Gefährdungen durch gefährliche Gaskonzentrationen sind entsprechende Schutzmaßnahmen festzulegen. Hierzu gehört die Vermeidung von möglichen Zündquellen, z. B. offenes Feuer und Rauchen.
Beispiele für Gefahrenbereiche von Flüssiggasanlagen bei Entleerung siehe 5.1.1.3 Beispielhafte Einteilung von Gefahrenbereichen und Zonen für unterschiedliche Flüssiggasanlagen.
Beispiele für Gefahrenbereiche von Flüssiggasflaschen bei Lagerung siehe 5.1.19 Lagerung von Flüssiggasflaschen.
Um das Eindringen von Flüssiggas in
- Gruben,
- Kanäle, Abflüsse zu Kanälen ohne Flüssigkeitsverschluss,
- Luftansaugöffnungen, Luft- und Lichtschächte,
- Kellerzugänge oder sonstige offene Verbindungen zu Kellerräumen,
- Öffnungen in Wänden und Decken zu anderen Räumen,
- Reinigungs- oder andere Öffnungen von Schornsteinen
zu verhindern, dürfen sich im Gefahrenbereich um betriebsbedingte Freisetzungsstellen der Versorgungsanlage bzw. des Druckgasbehälters, z. B. um das Flüssiggasflaschenventil, keine Öffnungen zu o. g. Einrichtungen befinden.
5.1.1.2 Zoneneinteilung im Freien und in Räumen
Bei Flüssiggasanlagen können in bestimmten Betriebssituationen gefährliche Gaskonzentrationen auftreten, die zum Entstehen von explosionsfähiger Atmosphäre führen können.
Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung ist zu ermitteln, ob eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre (g. e. A.) entstehen kann, z. B. beim Flaschenwechsel einer Mehrflaschenanlage.
Sofern das Ergebnis der Ermittlung ergibt, dass g. e. A. auftritt, sind Explosionsschutzmaßnahmen festzulegen!
Explosionsgefährdete Bereiche sind als Bereiche definiert, in denen die explosionsfähige Atmosphäre auf Grund der örtlichen und betrieblichen Verhältnisse auftreten kann.
Bei Tätigkeiten in Bereichen mit gefährlichen explosionsfähigen Gemischen, z. B. einem Flüssiggas-Luft-Gemisch, haben Unternehmerinnen und Unternehmer die Vorschriften für den Explosionsschutz nach den Vorgaben der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) zu beachten. Kann die Bildung gefährlicher explosionsfähiger Gemische nicht sicher verhindert werden, sind die Wahrscheinlichkeit und die Dauer des Auftretens gefährlicher explosionsfähiger Gemische sowie das mögliche Auftreten von wirksamen Zündquellen zu beurteilen. Abhängig vom Ergebnis dieser Beurteilung sind Maßnahmen zu ergreifen, um eine Zündung zu vermeiden.
Volumenverhalten von Flüssiggas Aus 1 Liter flüssigem Propan bilden sich beim Verdampfen ca. 260 Liter gasförmiges Propan und das Flüssiggas-Luft-Gemisch ist bereits bei einem Flüssiggasanteil von 1,5 Vol.-% (untere Explosionsgrenze (UEG)) in der Luft explosionsfähig. Bei der Freisetzung von 1 Liter Gasphase entstehen ca. 67 Liter gefährliche explosionsfähige Atmosphäre (1 l x 100/1,5 = 67 l). Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre (g. e. A.) Mehr als 10 Liter zusammenhängende explosionsfähige Atmosphäre müssen in geschlossenen Räumen unabhängig von der Raumgröße grundsätzlich als gefährliche explosionsfähige Atmosphäre angesehen werden. Auch kleinere Mengen können bereits gefahrdrohend sein, wenn sie sich in unmittelbarer Nähe von Menschen befinden. In Räumen von weniger als 100 m³ kann auch eine kleinere Menge als 10 Liter gefahrdrohend sein. Eine grobe Abschätzung hierzu ist mit Hilfe der Faustregel möglich, die in solchen Räumen explosionsfähige Atmosphäre von mehr als einem Zehntausendstel des Raumvolumens als gefahrdrohend ausweist, so dass z. B. in einem Raum von 80 m³ bereits 8 Liter eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre bilden. Weitere Angaben zur Beurteilung der Gefährlichkeit explosionsfähiger Atmosphäre sind in der TRGS 721 "Gefährliche explosionsfähige Gemische – Beurteilung der Explosionsgefährdung" zu finden. |
Gemäß den Anforderungen der GefStoffV können Unternehmerinnen oder Unternehmer explosionsgefährdete Bereiche in Zonen einteilen.
Wird auf eine Zoneneinteilung verzichtet, sind für den gesamten Gefahrenbereich die Anforderungen für die höchste Kategorie für alle elektrischen und nicht elektrischen Geräte gemäß der Richtlinie 2014/34/EU zu erfüllen, siehe Tabelle 2. Dies ist in der Regel nicht sinnvoll, da damit auf ein risikobasiertes Explosionsschutzkonzept verzichtet wird und unnötige Kosten für den Betreiber entstehen.
Es ist daher vorteilhaft, eine Zoneneinteilung für die Bereiche vorzunehmen, in denen mit dem Auftreten von gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gerechnet werden muss. Entsprechend der abgeschätzten Dauer und Häufigkeit für das Auftreten werden für Flüssiggas geometrische Bereiche mit der Zone 0, 1 oder 2 festgelegt.
Für explosionsfähige Gemische aus brennbaren Gasen (hier Flüssiggas) gelten die folgenden Zonendefinitionen:
Tabelle 1 Zoneneinteilung (Quelle: GefStoffV)
| Zoneneinteilung explosionsgefährdeter Bereiche | |
| Zone 0 | ist ein Bereich, in dem gefährliche explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebel ständig, über lange Zeiträume oder häufig vorhanden ist. |
| Zone 1 | ist ein Bereich, in dem sich im Normalbetrieb gelegentlich eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebel bilden kann. |
| Zone 2 | ist ein Bereich, in dem im Normalbetrieb eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebel normalerweise nicht auftritt, und wenn doch, dann nur selten und für kurze Zeit. |
Bei der Zoneneinteilung ist der Normalbetrieb einschließlich vorhersehbarer Tätigkeiten, z. B. Flaschenwechsel, zu betrachten. Störungsbedingte Austritte von Flüssiggas, z. B. infolge von mechanischen Beschädigungen, gehören nicht zum Normalbetrieb.
Für den bestimmungsgemäßen Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zonen) dürfen grundsätzlich nur Geräte der Kategorien
- II 1 G (für alle Zonen),
- II 2 G (für Zone 1 oder 2) und
- II 3 G (nur für Zone 2)
gemäß der Richtlinie 2014/34/EU für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden. Ausgenommen sind Geräte, die keine eigene Zündquelle besitzen.
Die Kategorien spiegeln die sicherheitstechnischen Anforderungen an Geräte für die Verwendung in einer bestimmten Zone wider.
Nachstehende Tabelle gibt eine Übersicht über die Zuordnung der Gerätekategorie zur Zone.
Tabelle 2 Zuordnung Gerätekategorien/Zonen
| Geräte- Kategorie |
Verwendung in Zone |
Geräte- Kennzeichnung1) |
Dokumente2) |
| 1 G | 0, 1, 2 |  |
EU-Baumusterprüfbescheinigung, EU-Konformitätserklärung des Herstellers, Betriebsanleitung |
| 2 G | 1, 2 |  |
Elektrisches Gerät: EU-Baumusterprüfbescheinigung, EU-Konformitätserklärung des Herstellers, Betriebsanleitung |
| 2 G | 1, 2 |  |
Nicht-elektrisches Gerät: EU-Konformitätserklärung des Herstellers, Betriebsanleitung |
| 3 G | 2 |  |
EU-Konformitätserklärung des Herstellers, Betriebsanleitung |
1) 9999 = Kennziffer der benannten Stelle
2) Die EU-Konformitätserklärung und die Betriebsanleitung müssen durch den Hersteller mitgeliefert werden.
5.1.1.3 Beispielhafte Einteilung von Gefahrenbereichen und Zonen für unterschiedliche Flüssiggasanlagen
Zur Erfüllung der unter 5.1.1 genannten Anforderungen sind als Hilfestellung die folgenden beispielhaften Zoneneinteilungen und Gefahrenbereiche für verschiedene Flüssiggasanlagen aufgeführt.
| Zusammenhang Zoneneinteilung und Gefahrenbereich Wird eine Zone festgelegt, ist dieser Bereich der Zone auch als Gefahrenbereich im Sinne dieser DGUV Regel anzusehen. Abhängig von der Gefährdungsbeurteilung im Einzelfall kann aber der Gefahrenbereich auch über den Bereich der Zonen hinausgehen. Weiterhin können Gefahrenbereiche auch festgelegt werden, wo keine Zoneneinteilung vorgenommen wird. Wird keine Zoneneinteilung vorgenommen bzw. liegt keine Zone vor, z. B. bei einer Einflaschenanlage mit direkt angeschraubter Druckregeleinrichtung und nach Kontrolle der Dichtheit, ist trotzdem eine Einteilung des Gefahrenbereiches durchzuführen. |
Bei der Beurteilung von Gefahrenbereich und Zone wird unterschieden, ob sich die Druckgasbehälter im Freien oder in Räumen befinden.
Einflaschenanlage
Bei einer Einflaschenanlage (siehe Abbildung 10) ist nicht mit dem Auftreten gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre (g. e. A.) zu rechnen, wenn die Anlage auf Dichtheit geprüft bzw. kontrolliert ist und beim Flaschenwechsel die austretende Gasmenge auf das eingeschlossene Volumen zwischen Flaschenventil-Ausgangsbereich und Druckregeleinrichtung-Eingangsbereich begrenzt ist.

Abb. 10 Einflaschenanlage mit direkt angeschraubter Druckregeleinrichtung (keine Zone nach Kontrolle der Dichtheit)
Dies ist unter folgenden Bedingungen der Fall:
- Die Druckregeleinrichtung ist direkt an das Flaschenventil angeschraubt und
- die Dichtheit des Anschlusses wurde kontrolliert, z. B. mit schaumbildenden Mitteln (DIN EN 14291: "Schaumbildende Lösungen zur Lecksuche an Gasinstallationen").
Wenn dies zutrifft, ist keine Zone vorhanden. Jedoch sind Zündquellen, wie z. B. offene Flammen, im Nahbereich des Flaschenventils bzw. der Druckregeleinrichtung während des Flaschenwechsels zu vermeiden. Auf ein Rauchverbot ist hinzuweisen.
Eine Festlegung des Gefahrenbereiches (siehe Abbildung 11) ist dennoch durchzuführen.
Gefahrenbereich
- im Freien
0,5 m um jede Anschlussstelle und kegelförmig bis zum Boden, am Boden r1/1 = 1 m - in Räumen
1 m um jede Anschlussstelle und kegelförmig bis zum Boden, am Boden r2/1 = 2 m
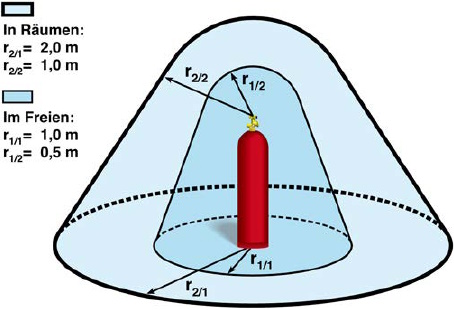
Abb. 11 Geometrische Abmessungen der Gefahrenbereiche einer Einflaschenanlage (Verzicht auf Darstellung von Druckregeleinrichtung, Rohrleitung und Verbrauchseinrichtung)
Mehrflaschenanlage
Im Aufstellungsbereich von Mehrflaschenanlagen ist beim Flaschenwechsel mit dem Auftreten einer gefährlichen explosionsfähigen Atmosphäre zu rechnen.
Mehrflaschenanlagen im Freien
a. Aufstellung im Freien:
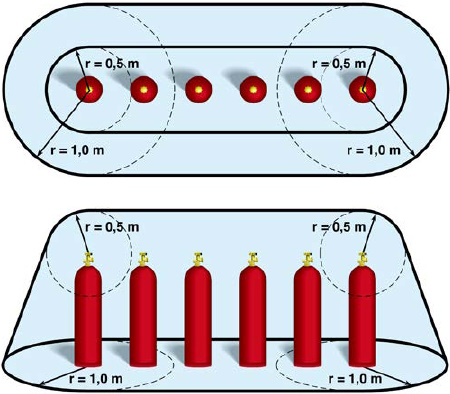
Abb. 12 Geometrische Abmessung von Gefahrenbereich und Zone einer Mehrflaschenanlage im Freien (Verzicht auf Darstellung von Druckregeleinrichtung, Rohrleitung und Verbrauchseinrichtung)
Bei den Mehrflaschenanlagen ist aufgrund der eingeschlossenen Gasmenge in der Rohrleitung infolge der betriebsbedingten Freisetzung von Flüssiggas, z. B. beim Flaschenwechsel, grundsätzlich von einer Zone auszugehen. Bei Erfüllung der Anforderungen entsprechend DGUV Regel 113-001 "Explosionsschutz-Regeln (EX-RL)" liegt Zone 2 vor mit folgenden geometrischen Abmessungen bei Mehrflaschenanlagen im Freien:
Zone 2:
0,5 m um jede Anschlussstelle und kegelförmig bis zum Boden, am Boden r = 1 m
Gefahrenbereich:
0,5 m um jede Anschlussstelle und kegelförmig bis zum Boden, am Boden r = 1 m
b. Aufstellung im Flaschenschrank
Bei Erfüllung der Anforderungen entsprechend DGUV Regel 113-001 "Explosionsschutz-Regeln (EX-RL)" wird folgende Zoneneinteilung bei Mehrflaschenanlagen im Flaschenschrank vorgenommen:
Zone 1:
im Innern des Flaschenschranks
Zone 2:
in der Umgebung r = 0,5 m um den Flaschenschrank bis Oberkante Flaschenschrank
Gefahrenbereich:
Im Innern des Flaschenschranks und in der Umgebung mit r = 0,5 m um den Flaschenschrank bis Oberkante Flaschenschrank
Hinweis: Entsprechend DGUV Regel 113-001 "Explosionsschutz-Regeln (EX-RL)" müssen Flaschenschränke je eine Lüftungsöffnung im Boden- und Deckenbereich mit einer Größe von 1 % der Grundfläche, mindestens jedoch von je 100 cm² besitzen und aus nichtbrennbaren Werkstoffen bestehen.

Abb. 13 Geometrische Abmessungen von Gefahrenbereich und Zonen einer Mehrflaschenanlage im Flaschenschrank
Mehrflaschenanlage im Aufstellungsraum
Bei Erfüllung der Anforderungen entsprechend DGUV Regel 113-001 "Explosionsschutz-Regeln (EX-RL)" wird folgende Zoneneinteilung bei Mehrflaschenanlagen im Aufstellungsraum vorgenommen:
Zone 1:
0,5 m um jede Anschlussstelle und kegelförmig bis zum Boden, am Boden r = 1 m
Zone 2:
übriger Raum sowie außen 0,5 m um die Lüftungsöffnungen
Gefahrenbereich:
Gesamter Raum sowie außen 0,5 m um die Lüftungsöffnungen
Die Abbildung 14 zeigt eine Mehrflaschenanlage im Aufstellungsraum mit nicht direkt angeschlossener Druckregeleinrichtung an der Flüssiggasflasche. Ungeregelter Druck steht von den zum Entleeren angeschlossenen Flüssiggasflaschen, den Absperrarmaturen über die Hochdruckschlauchleitungen und die jeweilige Seite des Sammelrohres bis zur Druckregeleinrichtung an.
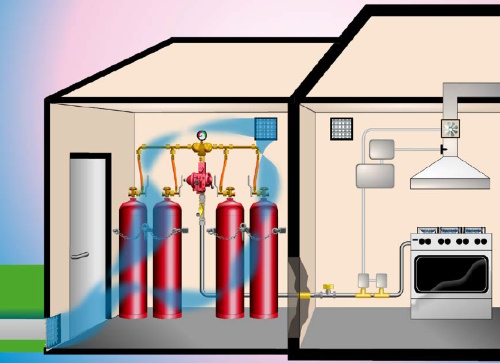
Abb. 14 Mehrflaschenanlage im Aufstellungsraum
In Aufstellungsräumen mit Flüssiggasflaschen
- dürfen sich keine Zündquellen befinden,
- müssen Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen den Anforderungen der für die jeweilige Zone geltenden Kategorie gemäß RL 2014/34/EU entsprechen (siehe Tabelle 2).
Bauliche Ausführung der Aufstellungsräume
Die Aufstellungsräume besitzen mindestens zwei ins Freie führende gegenüberliegende Lüftungsöffnungen im Boden- und Deckenbereich von mindestens jeweils 100 cm², siehe Abbildung 14. Die Innenwände der Aufstellungsräume zu anderen Räumen sind öffnungslos und gasdicht auszuführen.
Aufstellungsräume mit Flüssiggasflaschen müssen
- Türen haben, die unmittelbar ins Freie führen und nach außen aufschlagen,
- aus Bauteilen bestehen, die schwer entflammbar oder nichtbrennbar sind, ausgenommen Fenster und sonstige Verschlüsse von Öffnungen in Außenwänden,
- von anderen Räumen entsprechend Feuerwiderstandsklasse F 30 abgetrennt sein,
- von angrenzenden Räumen mit Brandlasten entsprechend Feuerwiderstandsklasse F 90 abgetrennt sein; bei Aufstellungsräumen mit einer Wärmedämmung genügt eine Abtrennung entsprechend Feuerwiderstandsklasse F 30.
Die Abtrennung von Räumen, die dem Aufenthalt von Menschen dienen (neben, unter oder über dem Aufstellungsraum), z. B. Sozialräume, muss entsprechend Feuerwiderstandsklasse F 90 ausgeführt sein.
Ortsfeste Flüssiggasanlage
Bei Erfüllung der Anforderungen entsprechend DGUV Regel 113-001 "Explosionsschutz-Regeln (EX-RL)" wird folgende Zoneneinteilung bei einem oberirdisch aufgestellten ortsfesten Druckgasbehälter vorgenommen.
Zone 1:
In einem Radius r = 1 m um das Füllventil bei häufiger Befüllung (> 12 mal im Jahr)
Zone 2:
1 m um das Füllventil und kegelförmig bis zum Boden, am Boden r = 3 m
Für Gasfüllanlagen ("Flüssiggastankstellen") gelten gemäß TRBS 3151/TRGS 751 abweichende Regelungen (Zone 1).
Durch geeignete Maßnahmen muss sichergestellt sein, dass die Anforderungen gemäß DGUV Regel 113-001 "Explosionsschutz-Regeln (EX-RL)" für die Zone 2 während der Dauer des Befüllvorganges eingehalten sind.
Eine geeignete Maßnahme kann die Kontrolle des Zonenbereiches auf Abwesenheit wirksamer Zündquellen sein. Wird die gefährliche explosive Atmosphäre (g. e. A.) nur während des Befüllvorganges erzeugt und können Freisetzungen zu anderen Zeiten, etwa durch Dichtheitsprüfungen, ausgeschlossen werden, so können potenziell wirksame Zündquellen in der ausgewiesenen Zone nach Einzelprüfung (Gefährdungsbeurteilung) zulässig sein, z. B. der Betrieb eines Rasenmähers. Bei wiederkehrenden gleichartigen Tätigkeiten mit Auftreten potenziell wirksamer Zündquellen innerhalb des Zonenbereiches, z. B. Rasen mähen, ist die Gefährdungsbeurteilung in der Regel nur vor der erstmaligen Ausführung der Tätigkeit erforderlich.
Erstreckt sich die Zone 2 auf Nachbargrundstücke, so ist während des Befüllvorganges der explosionsgefährdete Bereich entweder durch
- bauliche Maßnahmen, z. B. Einschränkung der Freisetzungsausbreitung an maximal zwei Seiten durch etwa öffnungslose, mindestens einseitig verputzte Wände oder
- andere schwadenhemmende Abtrennungen
zu begrenzen oder es sind entsprechende vertragliche Nutzungsvereinbarungen mit den Nachbarn zu treffen.
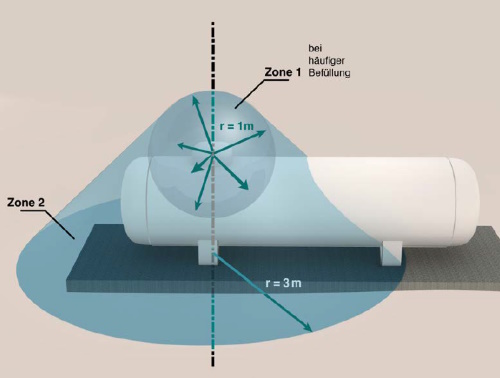
Abb. 15 Geometrische Abmessungen der Zone eines ortsfesten Druckgasbehälters im Freien (Verzicht auf Darstellung von Druckregeleinrichtung, Rohrleitung und Verbrauchseinrichtung)
Erstreckt sich die Zone 2 auf öffentliche Verkehrsflächen, so ist während des Befüllvorganges der explosionsgefährdete Bereich entweder durch
- bauliche Maßnahmen, z. B. Einschränkung der Freisetzungsausbreitung an maximal zwei Seiten durch etwa öffnungslose, mindestens einseitig verputzte Wände oder
- andere schwadenhemmende Abtrennungen
zu begrenzen.
Gefahrenbereich
In einem Radius von 5 m um betriebsbedingte Freisetzungsstellen wie z. B. Füllventile dürfen sich entsprechend den Regelungen der TRBS 3146/TRGS 746 "Ortsfeste Druckanlagen für Gase" keine
- Gruben,
- Kanäle, Abflüsse zu Kanälen ohne Flüssigkeitsverschluss,
- Luftansaugöffnungen, Luft- und Lichtschächte,
- Kellerzugänge oder sonstige offene Verbindungen zu Kellerräumen,
- Öffnungen in Wänden und Decken zu anderen Räumen,
- Reinigungs- oder andere Öffnungen von Schornsteinen
befinden.
5.1.2 Explosionsschutzdokument
Sobald das Auftreten von gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre nicht sicher verhindert werden kann, ist ein Explosionsschutzdokument nach § 6 (9) der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) zu erstellen. Das Explosionsschutzdokument enthält das Ergebnis der Beurteilung der Gefährdungen durch explosionsfähige Gemische und, falls erforderlich, die Zoneneinteilung sowie die festgelegten Schutzmaßnahmen zur Vermeidung von Explosionen, u. a. zur Vermeidung von Zündquellen, sowie die Festlegungen zu den erforderlichen Prüfungen.
| Weitere Informationen | |
|
Muster-Explosionsschutzdokumente siehe BGN Branchenwissen, Wissen Kompakt Flüssiggas www.bgn.de/754 |
|
Zu den organisatorischen Schutzmaßnahmen zum Explosionsschutz gehört auch die Festlegung von Maßnahmen für den Fall, dass Heißarbeiten, z. B. Schweißen, Schleifen etc., in explosionsgefährdeten Bereichen durchgeführt werden müssen: Vor der Durchführung von Feuer- und Heißarbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen ist auf Grundlage der TRBS 1112 Teil 1 eine Gefährdungsbeurteilung für die Instandhaltungsarbeiten durchzuführen. Für die Arbeiten ist ein dokumentiertes Freigabeverfahren vorzusehen, erforderlichenfalls durch Freimessen des betroffenen Bereiches, siehe DGUV Veröffentlichung FBFHB-008 "Erlaubnisschein für Schweiß-, Schneid-, Löt-, Auftau- und Trennschleifarbeiten" www.dguv.de > Webcode: p021360.
Es ist zweckmäßig, den Erlaubnisschein inklusive möglicher Anlagen als Nachweis einer systematischen Dokumentation mindestens 10 Jahre aufzubewahren, siehe hierzu BGN Branchenwissen, Wissen Kompakt Flüssiggas www.bgn.de/754.
5.1.3 Aufstellung von Flüssiggasanlagen
Flüssiggasanlagen bestehen aus der Versorgungs- und Verbrauchsanlage (siehe Abbildungen unter 3 Begriffsbestimmungen).
Neben der Beachtung der Regelungen zur Aufstellung (siehe 5.1.3.1 Aufstellung von Flüssiggasflaschenanlagen und 5.1.3.2 Aufstellung von ortsfesten Flüssiggasanlagen) ist am Aufstellungsort der Flüssiggasanlage eine Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung vorzunehmen. Diese wird z. B. auf dem ortsfesten Druckgasbehälter oder an der Tür des Aufstellungsraumes dauerhaft angebracht (siehe Abbildung 16).

Abb. 16 Sicherheitskennzeichen Flüssiggasanlagen bei Versorgung aus ortsfesten Druckgasbehältern (Quelle: DVFG)
5.1.3.1 Aufstellung von Flüssiggasflaschenanlagen
Aufstellungsräume und Aufstellplätze im Freien für Flüssiggasflaschen, z. B. Flaschenschränke, müssen entsprechend TRBS 3145/TRGS 745 mit den Warnzeichen W029 "Warnung vor Gasflaschen", D-W021 "Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre" und W021 "Warnung vor feuergefährlichen Stoffen" sowie den Verbotszeichen D-P006 "Zutritt für Unbefugte verboten" und P003 "Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten" entsprechend ASR A1.3 versehen sein (siehe auch 5.1.19 Lagerung von Flüssiggasflaschen).
Die Auswertung des Unfallgeschehens hat gezeigt, dass ein Hauptanteil der Unfälle auf Undichtheiten an den zuvor gelösten Verbindungsstellen nach dem Flaschenwechsel zurückzuführen ist. Deshalb ist die Kontrolle der Dichtheit nach dem Flaschenwechsel unerlässlich (siehe 5.1.11 Kontrolle der Dichtheit/Feststellung von Undichtheiten). Sollte es zu einer Undichtheit kommen, so ist es entscheidend, ob und in welchem Umfang sich eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre bilden kann. Ausschlaggebend hierfür sind u. a. die Belüftungsverhältnisse am Aufstellungsort. Diese sind im Freien naturgemäß besser als in Räumen. Aus diesem Grund muss zur Minimierung des Restrisikos, unter Berücksichtigung der Anforderungen im Abschnitt 5.1.1.2 Zoneneinteilung im Freien und in Räumen, die "Aufstellungspriorität" in der folgenden Reihenfolge beachtet werden.
|
Priorität 1: Die Flüssiggasflaschen müssen im Freien aufgestellt werden.
Abb. 17 Flaschenaufstellung im Freien (z. B. im Flaschenschrank) 1 verschließbarer Flaschenschrank Ist die Aufstellung im Freien nicht möglich, muss dies in der Gefährdungsbeurteilung begründet und dokumentiert werden. In diesem Fall ist zu prüfen, ob für die Aufstellung von Flüssiggasflaschen ein separater Aufstellungsraum zur Verfügung gestellt werden kann. |
|
Priorität 2: Aufstellung im separaten Aufstellungsraum Kriterien für den separaten Aufstellungsraum sind:
Abb. 18 Mehrflaschenanlage im separaten Aufstellungsraum Ergibt die Gefährdungsbeurteilung, dass die Aufstellung in Form der beiden vorgenannten Prioritäten (Aufstellung im Freien bzw. in einem Aufstellungsraum) nicht möglich ist, ist dies in der Gefährdungsbeurteilung zu begründen und zu dokumentieren. Nur in diesem Fall dürfen in einem Arbeitsraum Flüssiggasflaschen aufgestellt werden. |
|
Priorität 3: Aufstellung im Arbeitsraum In einem Arbeitsraum (z. B. Küchen) bis 500 m³ sowie für jeden weiteren 500 m³ Rauminhalt dürfen maximal
aufgestellt werden.
Abb. 19 Flaschenaufstellung im Arbeitsraum Nur in folgenden zu begründenden Ausnahmefällen dürfen bis zu acht Flüssiggasflaschen (Summe der angeschlossenen und bereitgehaltenen Flüssiggasflaschen) mit jeweils maximal 16 kg zulässigem Füllgewicht aufgestellt werden:
|
Bei der Aufstellung von Flüssiggasflaschenanlagen müssen weitere Anforderungen beachtet werden:
1. Verbrauchsanlagen dürfen nur an höchstens 8 Flüssiggasflaschen zur gleichzeitigen Entleerung angeschlossen werden.
2. Flüssiggasanlagen müssen so errichtet und aufgestellt werden, dass sie sicher betrieben und instandgehalten werden können.
3. Flüssiggasanlagen müssen so aufgestellt werden, dass sie gegen mechanische Beschädigung geschützt sind.
4. Flüssiggasflaschen müssen so aufgestellt werden, dass sie gegen unzulässige Erwärmung geschützt sind.
Eine unzulässige Erwärmung ist bei Flüssiggasflaschen nicht anzunehmen, wenn das Flüssiggas in der Flasche nicht höher als 40 °C erwärmt wird.
In der Regel sind zu Wärmequellen folgende Mindestabstände für Flüssiggasflaschen ausreichend (siehe Tabelle 3).
Tabelle 3 Wärmequellen/Mindestabstände
| Wärmequellen | Mindestabstände | |
| ohne Strah- lungs- schutz |
mit wirk- samem Strah- lungs- schutza) |
|
| von Heizgeräten, Feuerstätten und ähnlichen Wärmequellen | 0,70 m | 0,30 m |
| von Heizkörpernb) | 0,50 m | 0,10 m |
| von Gasherden und ähnlichen Wärmequellen | 0,30 m | 0,10 m |
a) aus nichtbrennbarem Material z. B. ein Strahlungsschutzblech
b) bei Vorlauftemperaturen von unter 60 °C ist ein Abstand von 10 cm ohne Strahlungsschutz ausreichend (Quelle: TRF 2021)
Von den geringeren Abständen (Spalte 3 der Tabelle 3) kann nur dann ausgegangen werden, wenn durch den Strahlungsschutz nachweislich keine unzulässige Erwärmung (höher als 40 °C) eintritt, z. B. durch
- ausreichend große Dimensionierung unter Beachtung der Größe der Flüssiggasflasche
- die Verwendung eines Strahlungsschutzes, der aus nichtbrennbaren Stoffen besteht,
- die feste Montage zwischen Wärmequelle und Flüssiggasflasche.
Flüssiggasflaschen dürfen in oder unter Verbrauchseinrichtungen nur aufgestellt werden, wenn
- sie sich nicht im unmittelbaren Strahlungsbereich der Brennerflamme befinden,
- die Einrichtungen so ausgeführt sind, dass sie die Flüssiggasflaschen vor unzulässiger Erwärmung höher als 40 °C schützen, z. B. wenn die heißen Abgase der Verbrauchseinrichtung von der Feuerstätte durch ein Verbindungsstück in den Kamin geleitet werden.
5. Flüssiggasanlagen müssen so aufgestellt werden, dass sie nicht öffentlich zugänglich sind oder die Sicherheitseinrichtungen, Regeleinrichtungen und Stellteile an der Versorgungsanlage gegen unbefugten Zugriff Dritter gesichert sind.
Dies ist z. B. erfüllt durch- verschließbare Schutzhauben,
- verschließbare Flaschenschränke,
- bauliche Maßnahmen, z. B. gemauerte Einfriedungen mit abschließbarer Tür,
- ständige Beaufsichtigung, z. B. auf Märkten.
Ständige Beaufsichtigung bedeutet, dass sich an jeder durch Dritte zugänglichen Anlage mindestens ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin immer in der Nähe aufhalten, die beauftragt und unterwiesen sind
oder
durch die Arbeitsweise eine ständige Beobachtung gewährleistet ist, z. B. bei Arbeiten mit Handbrennern.
6. Flüssiggasanlagen dürfen nicht in Räumen unter Erdgleiche aufgestellt werden. Dies gilt nicht
- für ortsfeste Verbrauchsanlagen, wenn die Festlegungen unter 5.2.9 Aufstellung von ortsfesten Verbrauchsanlagen in Räumen unter Erdgleiche eingehalten sind,
- für in Gebrauch befindliche Handwerkerflaschen bzw. Ventilkartuschen mit einem Rauminhalt von nicht mehr als 1 Liter,
- wenn das Aufstellen von Verbrauchsanlagen, die aus Flüssiggasflaschen versorgt werden, zur Ausführung von Arbeiten dort vorübergehend notwendig ist und besondere Schutzmaßnahmen getroffen sind, siehe auch
5.1.8 Schlauchleitungen/Sicherungen bei Schlauchbeschädigungen.
7. In Treppenräumen, engen Höfen sowie Durchgängen und Durchfahrten oder in deren unmittelbarer Nähe dürfen Flüssiggasflaschen nur aufgestellt werden, wenn dies zur Ausführung von Arbeiten dort vorübergehend notwendig ist und besondere Sicherheitsmaßnahmen durch die Unternehmerin oder den Unternehmer getroffen sind.
Vorübergehendes Aufstellen ist z. B. bei Instandhaltungsarbeiten erforderlich.
Besondere Sicherheitsmaßnahmen sind z. B.
- Absperrungen, Sicherung des Flucht- und Rettungsweges,
- Lüftungsmaßnahmen.
8. Verbrauchseinrichtungen müssen standsicher aufgestellt werden. Dies gilt nicht für solche Verbrauchseinrichtungen, die während des Betriebes von Hand geführt werden.
9. Bei Verbrauchsanlagen mit angeschlossenen Flüssiggasflaschen ab 1 Liter Inhalt, denen Gas aus der Gasphase entnommen wird, müssen die Flüssiggasflaschen aufrechtstehend und standsicher aufgestellt werden.
Dies bedeutet in der Praxis:
- Die Aufstellfläche muss eben sein und
- soweit Zugbeanspruchung über Schlauchleitungen nicht ausgeschlossen ist, müssen die Flüssiggasflaschen gegen Umfallen gesichert werden, z. B. durch Ketten.
Aus den genannten Gründen müssen daher insbesondere die 33-kg-Flüssiggasflaschen aufgrund ihrer hohen Kippgefährdung gegen Umfallen gesichert werden.
So genannte Handwerkerflaschen sind 1-Liter-Flaschen. Da die Entnahme aus der Gasphase erfolgt, dürfen diese nur aufrechtstehend oder hängend betrieben werden.
10. In Nischen von weniger als 2 m² Bodenfläche ist die Aufstellung von Flüssiggasflaschen weder in Flaschenschränken noch im Freien zulässig, sofern infolge Undichtheiten ausströmendes Gas nicht gefahrlos abfließen kann.
11. Durch ausreichende Abstände oder andere geeignete Schutzmaßnahmen ist sicherzustellen, dass durch Verbrauchsanlagen keine unzulässigen Temperaturen an Bauteilen aus brennbaren Stoffen entstehen.
Dies ist z. B. sichergestellt, wenn an den Oberflächen von Bauteilen mit brennbaren Stoffen bei Nennwärmebelastung keine höheren Temperaturen als 85 °C auftreten können.
Bei abgasführenden Teilen ist diese Forderung erfahrungsgemäß erfüllt, wenn z. B. ein Abstand von 0,1 m zu Bauteilen aus brennbaren Stoffen eingehalten ist.
Bei Durchbrüchen durch Bauteile ist diese Forderung z. B. erfüllt, wenn der Abstand durch Schutzrohre mit Abstandshaltern eingehalten und der Zwischenraum mit nichtbrennbaren, formbeständigen Baustoffen geringer Wärmeleitfähigkeit ausgefüllt ist.
Andere Schutzmaßnahmen sind z. B. Wärmedämmung oder Belüftung gegen Wärmestrahlung.
Zu den Bauteilen aus brennbaren Baustoffen zählen z. B. auch Einbaumöbel.
Unzulässige Temperaturen können entstehen durch
- Wärmebelastung,
- Wärmestrahlung,
- Glimmstellen,
- Funkenflug oder
- Flammeneinwirkung.
12. In Räumen und Bereichen, in denen mit explosionsfähiger Atmosphäre gerechnet werden muss, dürfen Verbrauchseinrichtungen nur unter Beachtung der Explosionsschutzmaßnahmen in Betrieb genommen werden, siehe 5.1.1 Gefahrenbereiche und Zonen.
13. Außerdem ist sicherzustellen, dass Verbrauchsanlagen, bei denen ein Austritt unverbrannten Gases und die Bildung einer gefährlichen explosionsfähigen Atmosphäre nicht sicher verhindert ist, so aufgestellt werden, dass die Gefahrenbereiche und Zonen um
- mögliche Gasaustrittstellen und
- Lüftungsöffnungen von Aufstellungsräumen
eingehalten werden.
Der Gefahrenbereich darf nur durch bauliche oder gleichwertige Maßnahmen begrenzt sein, wenn die Lüftung nicht unzulässig behindert wird, siehe 5.1.1 Gefahrenbereiche und Zonen.
14. Die gewerbliche Verwendung von Flüssiggasflaschen mit innenliegendem Ventil nach DIN EN ISO 14245 ist verboten. Bei den im Gewerbe bekannten Flüssiggasflaschen sind Flaschenventile inkl. Sicherheitsventile bereits im Auslieferungszustand dicht eingebaut, dies ist bei den Flüssiggasflaschen mit innenliegendem Ventil nicht der Fall.
5.1.3.2 Aufstellung von ortsfesten Flüssiggasanlagen
Vor der Aufstellung und Inbetriebnahme einer ortsfesten Flüssiggasanlage hat die Unternehmerin oder der Unternehmer im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung die Flüssiggasanlage zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen festzulegen.
Bei der Auswahl des Aufstellungsortes sind insbesondere folgende Punkte zu beachten:
- Schutz des ortsfesten Druckgasbehälters vor dem Eingriff Unbefugter. Dies kann z. B. erreicht werden durch Umfriedung des ortsfesten Druckgasbehälters und Einschluss der Armaturen, z. B. mit einem abschließbaren Domdeckel.
- Die erforderlichen Sicherheits- und Schutzabstände gemäß TRF 2021 Ziffer 5.3.5.2 müssen eingehalten werden.
- In Durchgängen, Durchfahrten, allgemein zugänglichen Fluren, Treppenräumen oder an Treppen von Freianlagen dürfen ortsfeste Druckgasbehälter nicht aufgestellt werden. Ferner dürfen Verkehrswege und Fluchtwege nicht eingeschränkt werden. Ortsfeste Druckgasbehälter müssen für befugte Personen immer zugänglich sein.
- Es müssen ausreichende Abstände – zum nächsten Druckgasbehälter oder zu einer Wand – für die Reinigung, die Prüfung und die Instandhaltung, für Flucht- und Rettungswege sowie für die Maßnahmen zur Kühlung vorhanden sein. In der Regel sind
- mindestens 1 m und
- bei Druckgasbehälterwandungen ohne Öffnung mindestens 0,5 m
- Ortsfeste Flüssiggasanlagen müssen für Prüfungen, Wartungen und Instandhaltungen zugänglich sein oder zugänglich gemacht werden können. Das Typenschild muss gut erkennbar sein.
- Ortsfeste Flüssiggasanlagen und deren Ausrüstung müssen gegen mechanische Einwirkungen von außen, z. B. infolge Fahrzeuganprall, so geschützt werden, dass Beschädigungen vermieden werden.
- Ortsfeste Flüssiggasanlagen sind gegen eine unzulässige Eigen- oder Fremderwärmung zu schützen.
Die Unternehmerin oder der Unternehmer hat bereits bei der Planung der Flüssiggasanlage im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung den geeigneten Aufstellungsort zu ermitteln und festzulegen.
5.1.4 Anschluss von Verbrauchsanlagen
Bei der Planung einer Flüssiggasanlage muss die Dimensionierung der Versorgungsanlage auf die Verbrauchsanlage abgestimmt werden. Hierfür ist eine fachkundige Beratung notwendig. Dies ist wichtig, um einen störungsfreien Betrieb ohne Vereisung der Flüssiggasflasche und des Flaschenventils zu gewährleisten. Die Vereisung stellt sich immer dann ein, wenn zu hohe Gasmengen aus der Gasphase entnommen werden.
| Eine vereiste Flüssiggasflasche ist nicht leer! Es kann weiter zum Austritt von Flüssiggas kommen. Auch deshalb muss vor jedem Flaschenwechsel zur Sicherheit das Flaschenventil zugedreht werden! |
Mit der optimalen Auswahl der Flaschengröße sowie der Anzahl der parallel installierten Flüssiggasflaschen kann unter Berücksichtigung der Entnahmeart ein störungsfreier Betrieb erreicht werden, siehe Tabelle 4.
|
Rechenbeispiel für eine Verbrauchseinrichtung mit 24 kW Nennwärmebelastung Der Heizwert von 1 kg Propan entspricht 12,87 kWh. Berechnung: 24 kW : 12,87 kWh/kg = 1,86 kg/h Für den Betrieb eines Gasgerätes mit einer Nennwärmebelastung von 24 kW ist eine Entnahmeleistung von ca. 1,86 kg/h erforderlich. Entsprechend der Entnahmeart (kurzzeitig, periodisch, Dauerentnahme) wird z. B. für Dauerentnahme durch die parallele Installation von min. 3 x 33 kg Flüssiggasflaschen die erforderliche Gasmenge von 1,8 kg/h (3 x 0,6 kg/h) zur Verfügung gestellt. |
Aus den vorgenannten Gründen muss dafür gesorgt werden, dass Verbrauchsanlagen an Versorgungsanlagen nur angeschlossen werden, wenn unter Berücksichtigung der Gesamtnennwärmebelastung aller Verbrauchseinrichtungen und der Entnahmeart keine den Betriebsablauf störende Unterkühlung der Versorgungsanlage eintritt.
| Vereisungen, die infolge zu hoher Gasentnahme entstanden sind, dürfen nur durch langsames Auftauen beseitigt werden. Offenes Feuer, glühende Gegenstände und Strahler dürfen zum Auftauen nicht verwendet werden. Vereisungen dürfen nicht abgeschlagen werden. |
Das Auftauen von Vereisungen oder die Erwärmung von Flüssiggasflaschen erfolgt zweckmäßigerweise mit Warmluft oder Warmwasser mit einer überwachten Temperatur von maximal 40 °C.
Treten Vereisungen an der Flüssiggasanlage auf, so muss sich der Unternehmer oder die Unternehmerin hinsichtlich der Dimensionierung der Versorgungsanlage fachkundig beraten lassen.
Tabelle 4 Entnahmeart – maximale Entnahmeleistung bei Flaschengröße in kg/h bei Raumtemperatur
| Entnahmeart | Entnahmeleistung bei entsprechender Flaschengröße in kg/h | ||
| 5 kg | 11 kg | 33 kg | |
| Kurzzeitige bzw. bei stoßweiser Entnahme (ca. 20 Min.) | 1,5 kg/h | 2,0 kg/h | 3,0 kg/h |
| Periodische Entnahme bzw. bei 50 % Unterbrechungen | 0,5 kg/h | 0,8 kg/h | 1,8 kg/h |
| Dauerentnahme | 0,2 kg/h | 0,3 kg/h | 0,6 kg/h |
Quelle: TRF 2012 Kommentar: 2014
Gelangt Flüssiggas in der Flüssigphase in die Druckregeleinrichtung, so durchfließt es diese und expandiert erst in der Rohrleitung vor den Gasgeräten. Dadurch kommt es zu einem unzulässig hohen Druck im Rohrleitungssystem. Aus diesem Grund muss beim Anschluss der Verbrauchsanlage an die Versorgungsanlage sichergestellt werden, dass Flüssiggas nicht unbeabsichtigt in flüssiger Phase in die Rohrleitung gelangt.
Dies wird sichergestellt, indem Flüssiggas nur aus
- der aufrechtstehenden Flüssiggasflasche oder
- aufrechtgehaltenen Einwegbehältern
entnommen wird und Treibgasflaschen nur für Treibgaszwecke verwendet werden.
Für den Betrieb aus der Flüssigphase sind z. B. Zerstäubungsbrenner geeignet, siehe 5.2.6 Verbrauchsanlagen mit Zerstäubungsbrennern.
- Verbrauchsanlagen dürfen nur an Versorgungsanlagen angeschlossen werden, wenn sie den zu erwartenden Beanspruchungen insoweit genügen, dass Beschäftigte nicht gefährdet werden. Diese Forderung schließt bei Einwegbehältern (Kartuschen) ein, dass ausschließlich solche mit Entnahmeventil verwendet werden.
- Verbrauchseinrichtungen dürfen nicht direkt an den Anschlussstutzen des Ventils der Flüssiggasflasche angeschlossen werden.
5.1.5 Montage/Anschluss der Druckregeleinrichtungen oder der Hochdruckschlauchleitungen an Flüssiggasflaschen
Kontrolle der Dichtheit
Nach der Herstellung der Anschlussverbindung (Druckregeleinrichtung an Flaschenventil bzw. Hochdruckschlauch an Flaschenventil) muss diese bei geöffnetem Flüssiggasflaschen-Absperrventil und geschlossenem Mehrfachstellgerät auf Dichtheit kontrolliert werden, z. B. mit schaumbildenden Mitteln. Die Dichtheitskontrolle ist vor Inbetriebnahme der Flüssiggasanlage durchzuführen (siehe 5.1.11 Kontrolle der Dichtheit/Feststellung von Undichtheiten).
Aufgrund der unterschiedlichen Dichtsysteme bei gleicher Gewindegröße der Flaschenventil-Ausgangsanschlüsse ist zu unterscheiden zwischen
|
| Druckregeleinrichtungen an Flüssiggasflaschen dürfen nur angeschlossen werden, wenn die Anschlüsse aufeinander abgestimmt sind. |
| Die Anschlüsse der Druckregeleinrichtungen und der Hochdruckschlauchleitungen an Flüssiggasflaschen besitzen ein Linksgewinde. |
| Weitere Informationen | |
| Muster-Betriebsanweisung "Wechsel von Flüssiggasflaschen" siehe BGN Branchenwissen, Wissen Kompakt Flüssiggas www.bgn.de/754 | |
Flüssiggas-Kleinflaschen
Kleinflaschen (3 kg ≤ Füllgewicht ≤ 16 kg) haben ein Flaschenventil, bei dem sich ausgangsseitig ein Gummidichtring im Entnahmestutzen befindet, der zur Ausrüstung des Ventils gehört (siehe Abbildung 21). Die Abdichtung gegen den Gummidichtring erfolgt durch einen metallischen Vorsprung an der Druckregeleinrichtung (S2SR), indem die Überwurfmutter der Druckregeleinrichtung oder des Hochdruckschlauches mit Handkraft an das Flaschenventil angeschraubt wird.
| Bei einem Fehlen des Gummidichtringes im Flaschenventil kann keine dichte Verbindung zwischen Druckregeleinrichtung und Flaschenventil hergestellt werden. Das Vorhandensein und der Zustand des Gummidichtringes müssen vor dem Anschließen kontrolliert werden. |
| Zur Herstellung einer dichten Verbindung zwischen Kleinflasche und Druckregeleinrichtung darf keine Zange benutzt werden, weil das dadurch aufgebrachte Drehmoment zur Zerstörung des Dichtringes und der Geometrie der Überwurfmutter führt. Im Fachhandel sind "Montagehilfen" zu erwerben, mit denen das notwendige begrenzte Drehmoment aufgebracht werden kann. |

Abb. 20 Kleinflaschenanschluss/Druckregeleinrichtung festschrauben (Drehrichtung links)

Abb. 21 Absperrventil der Kleinflasche mit Gummidichtring im Entnahmestutzen und zugehöriger Druckregeleinrichtung
Flüssiggas-Großflaschen
Großflaschen (> 16 kg Füllgewicht, z. B. 33 kg-Flüssiggasflaschen) haben ein Absperrventil mit einer metallischen Flachdichtfläche am Ausgangsanschluss – also keinen Dichtring. Zur Abdichtung des Anschlusses am Absperrventil befindet sich eine Flachdichtung aus Aluminium oder Kunststoff in der Druckregeleinrichtung (OPSO) oder im Hochdruck-Schlauch (siehe Abbildung 22). Diese muss in einem einwandfreien Zustand und selbsthaltend in der Anschlussarmatur eingesetzt sein.
| Vor dem Aufschrauben der Sechskantmutter auf das Absperrventil muss immer kontrolliert werden, ob die Flachdichtung vorhanden und unbeschädigt ist. |
| Das notwendige Drehmoment für einen dichten Anschluss wird durch den Einsatz eines nicht funkenschlagenden Gabelschlüssels der Schlüsselweite 30 erzeugt. Auch bei der Montage des Großflaschenanschlusses ist der Einsatz von Zangen verboten. Diese zerstören dauerhaft die Geometrie der Sechskantmutter, führen zu vorzeitigen Instandhaltungsmaßnahmen und somit zu unnötigen Kosten für den Betrieb. |

Abb. 22 Absperrventil der Großflasche und Hochdruckschlauchanschluss (PS 30 bar) mit Flachdichtung in der Sechskantmutter
5.1.6 Druckregeleinrichtungen und Sicherheitseinrichtungen
Die Druckregeleinrichtung und die zugehörigen Sicherheitseinrichtungen haben die Aufgabe, den ungeregelten Druck der Versorgungsanlage auf den erforderlichen Betriebsdruck der Verbrauchsanlage zu regeln. So muss z. B. der Nennausgangsdruck der Druckregeleinrichtung mit dem Nennbetriebsdruck des Gasverbrauchsgerätes übereinstimmen.
Beim Betrieb von Flüssiggasanlagen im Druckbereich größer 100 mbar sind spezielle Anforderungen an die Druckregeleinrichtungen zu beachten, siehe 5.1.6.2 Druckregeleinrichtungen in Mitteldruckanlagen mit Flüssiggasflaschen.
Die DIN 4811 "Flüssiggas-Druckregelgeräte und Sicherheitseinrichtungen – Anforderungen" legt als Auswahlnorm für die Verwendung der Druckregeleinrichtungen in Deutschland die Anforderungen und Betriebsbedingungen an Flüssiggasdruckregeleinrichtungen und deren Sicherheitseinrichtungen fest. Basis hierfür ist die DIN EN 16129 "Druckregelgeräte, automatische Umschaltanlagen mit einem höchsten Ausgangsdruck bis einschließlich 4 bar und einem maximalen Durchfluss von 150 kg/h sowie die dazugehörigen Sicherheitseinrichtungen und Übergangsstücke für Butan, Propan und deren Gemische".
Umschalteinrichtungen
Zur Erhöhung der Entnahmeleistung kann die Anzahl der Flüssiggasflaschen, aus denen parallel entnommen wird, erhöht werden (siehe 5.1.4 Anschluss von Verbrauchsanlagen). Um einen unterbrechungsfreien Betrieb der Verbrauchsanlage zu ermöglichen, können automatische oder manuelle Umschalteinrichtungen verwendet werden. Automatische Umschalteinrichtungen sind Druckregeleinrichtungen, die als Kombination mit einem integrierten Niederdruckregler ausgerüstet sind oder mit einem Niederdruckregler ergänzt werden müssen. Automatische Umschalteinrichtungen schalten automatisch von der leeren Betriebs- auf die volle Reserveseite um. Abbildung 17 zeigt beispielhaft eine Zweiflaschenanlage mit einer automatischen Umschalteinrichtung.
Alternativ können auch manuelle Umschalteinrichtungen eingesetzt werden, bei denen wahlweise aus der Betriebs- oder Reserveseite entnommen wird.
| Bei Niederdruckanlagen darf als Umschalteinrichtung keine Absperrarmatur mit Handrad installiert sein, weil eine dichte Sperrstellung optisch nicht erkennbar ist. |
5.1.6.1 Druckregeleinrichtungen in Niederdruckanlagen mit Flüssiggasflaschen
Entnahmemengen ≤ 1,5 kg/h
Bei der Versorgung aus einer Kleinflasche (bis 16 kg) muss die Absicherung der Verbrauchseinrichtung grundsätzlich durch eine zweistufige Sicherheitsdruckregeleinrichtung "S2SR" (bisherige Bezeichnung: Überdrucksicherheitseinrichtung (ÜDS)) mit einer maximalen Entnahmemenge von 1,5 kg/h erfolgen.
| Bei Druckregeleinrichtungen mit Anzeigevorrichtung, z. B. einer Rot-/Grün-Sichtanzeige, erkennt der Betreiber, dass die defekte Druckregeleinrichtung (Sichtanzeige rot) ausgetauscht werden muss, siehe Abbildung 23. Nach Austausch und vor Wiederinbetriebnahme muss eine Prüfung durch eine zur Prüfung befähigte Person für Flüssiggasanlagen durchgeführt werden. |

Abb. 23 Druckregeleinrichtung S2SR mit TAE, Manometer und Sichtanzeige; Sichtanzeige:
grün bei 50 mbar Betriebsdruck
rot bei Ausgangsdruck über 80 mbar
Steht die Flüssiggasflasche in einem Gebäude, wird zusätzlich eine thermisch auslösende Absperreinrichtung (TAE) benötigt (Kennzeichnung der Druckregeleinrichtung mit "T" oder "F1-t"), die integriert am Eingang der Druckregeleinrichtung angebracht ist.
Aus einer Flüssiggasflasche ≤ 16 kg Füllgewicht ist nur kurzzeitig eine Entnahme von 1,5 kg/h möglich.
|
Die zweistufige Sicherheitsdruckregeleinrichtung verfügt eingangsseitig über eine Überwurfmutter für den Anschluss an Flüssiggasflaschen ≤ 16 kg Füllgewicht, den sogenannten Kleinflaschenanschluss.
Zu beachten ist, dass die zweistufige Sicherheitsdruckregeleinrichtung "S2SR" mit Überwurfmutter nur für den Anschluss an eine Kleinflasche vorgesehen ist und nicht für den Anschluss an eine Großflasche (Füllgewicht > 16 kg) verwendet werden darf, da aufgrund unterschiedlicher Dichtsysteme keine Dichtheit zu erzielen ist. Nur eine zweistufige Sicherheitsdruckregeleinrichtung "S2SR" mit "Kombinationsanschluss", der eingangsseitig über eine Sechskantmutter verfügt, darf aufgrund ihrer Bauart sowohl an Flüssiggasflaschen mit Kleinflaschenventil als auch an Flüssiggasflaschen > 16 kg ≤ 33 kg Füllgewicht angeschlossen werden. |
| Weitere Informationen | |
| Muster-Betriebsanweisung "Wechsel von Flüssiggasflaschen" siehe BGN Branchenwissen, Wissen Kompakt Flüssiggas www.bgn.de/754 | |
Entnahmemengen > 1,5 kg/h
Bei größeren Entnahmemengen als 1,5 kg/h sind Druckregeleinrichtungen mit zusätzlicher Überdruck-Sicherheitsabsperreinrichtung (englisch: Over-Pressure Shut Off (OPSO); bisherige Bezeichnung: Sicherheitsabsperrventil (SAV)) sowie einem Überdruck-Abblaseventil mit begrenztem Durchfluss (PRV) erforderlich. Die Sicherheitsabsperreinrichtung (OPSO) ist eine Einrichtung, die im normalen Betrieb geöffnet (betriebsbereit) ist und die Aufgabe hat, den Gasstrom selbsttätig abzusperren, sobald der Druck in dem abzusichernden System einen oberen Ansprechdruck erreicht. Sie öffnet sich nach dem Sperren nicht selbsttätig.
Zusätzlich zu der Überdruck-Sicherheitsabsperreinrichtung (OPSO) kann diese Druckregeleinrichtung herstellerseitig auch mit einer Unterdruck-Sicherheitsabsperreinrichtung (UPSO) ausgestattet werden. Diese kombinierte Überdruck-Unterdruck-Sicherheitsabsperreinrichtung (OPSO/UPSO) soll einen nichtbestimmungsgemäßen Gasaustritt verhindern. Im Falle eines nichtbestimmungsgemäßen Gasaustrittes, z. B. bei Beschädigung der Rohrleitung, sperrt die Unterdruck-Absperreinrichtung (UPSO) selbstständig die weitere Gaszufuhr aus der Versorgungsanlage, sobald ein unzulässig niedriger Druck in der Rohrleitung ansteht. Sie öffnet sich nach dem Sperren nicht selbsttätig. Durch die Installation dieser Druckregeleinrichtung soll ein Brand- bzw. Explosionsereignis mit meist schwerwiegenden Folgen vermieden werden.
Als sicherheitsrelevante Ausrüstung wird für die Verwendung im gewerblichen Bereich eine automatisch wirkende kombinierte Überdruck-Unterdruck-Sicherheitsabsperreinrichtung (OPSO/UPSO) empfohlen.
Bei der Verwendung von o. g. Druckregeleinrichtungen im Arbeitsraum muss eine Abblaseleitung ins Freie verlegt werden.
Beispiele für OPSO/UPSO Druckregeleinrichtungen mit unterschiedlichen Versorgungsleistungen:
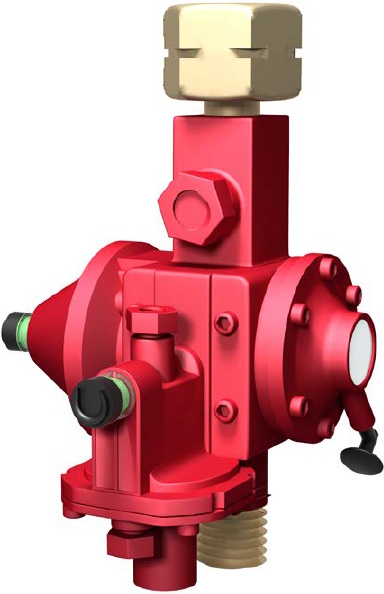
Abb. 24 OPSO/UPSO Druckregeleinrichtung mit Überdruck-Abblaseventil mit begrenztem Durchfluss (Pressure Relief Valve (PRV)) und einer Versorgungsleistung von z. B. 4 kg/h

Abb. 25 OPSO/UPSO Druckregeleinrichtung mit Überdruck-Abblaseventil mit begrenztem Durchfluss (Pressure Relief Valve (PRV)) und einer Versorgungsleistung von z. B. 12 kg/h
5.1.6.2 Druckregeleinrichtungen in Mitteldruckanlagen mit Flüssiggasflaschen
Bei allen Flüssiggasanlagen, die mit einem festen oder verstellbaren Ausgangsdruck > 100 mbar bis 4 bar (Mitteldruck) betrieben werden, benötigt die Druckregeleinrichtung nach DIN 4811 Abschnitt 4.5 wahlweise (je nach Einsatzgebiet) folgende Sicherheitseinrichtung:
- OPSO nach DIN EN 16129: A.2, in Verbindung mit einem Überdruck-Abblaseventil mit begrenztem Durchfluss (Pressure Relief Valve (PRV)) nach DIN EN 16129: A.1 und falls Schlauchleitungen > 0,4 m direkt an die Druckregeleinrichtung angeschlossen werden, je nach Einsatzzweck (siehe 5.1.8 Schlauchleitungen/Sicherungen bei Schlauchbeschädigungen):
- Strömungswächter (EFV) nach DIN EN 16129: A.4 oder
- Leckgassicherung nach Anhang E, DIN 4811, z. B. im Falle von Arbeiten unter Erdgleiche.
Die Nennansprechdrücke von OPSO und PRV sind in Tabelle 7 der DIN 4811 festgelegt.
An einer Druckregeleinrichtung, die an eine Flüssiggasflasche oder -flaschenanlage angeschlossen wird und einen verstellbaren Ausgangsdruck besitzt, muss zur reproduzierbaren Einstellung und Anzeige des eingestellten Betriebsdrucks entweder eine Zahlenskala oder ein Manometer vorhanden sein, siehe Abbildung 26.

Abb. 26 Mitteldruckregeleinrichtung mit Leckgassicherung
Im Baubereich dürfen bei ständiger Beaufsichtigung ortsveränderliche Verbrauchsanlagen ohne Einrichtungen gegen ungeregelten Druckanstieg betrieben werden.
5.1.6.3 Druckregeleinrichtungen in Niederdruckanlagen mit ortsfestem Druckgasbehälter
Bei der Entnahme von Flüssiggas aus einem ortsfesten Druckgasbehälter mit ungeregeltem Eingangsdruck und einem festen Nennausgangsdruck von 0,05 bar (50 mbar) zur Versorgung von Gasgeräten ist die DIN 4811 Abschnitt 4.2 und 4.3 zu beachten. Diese Abschnitte legen die Anforderungen sowohl für Druckregeleinrichtungen der ersten Stufe als auch für Druckregeleinrichtungen, in denen die erste und zweite Stufe vereinigt ist (Gerätekombination), sowie für deren Sicherheitseinrichtungen fest. Danach muss der Ausgangsdruck der Druckregeleinrichtung durch eine Überdruck-Sicherheitsabsperreinrichtung (OPSO bzw. alt SAV) in Verbindung mit einem Überdruck-Abblaseventil mit begrenztem Durchfluss (PRV) nach Tabelle 1, DIN 4811 Abschnitt 4.2.4 abgesichert sein.
Als sicherheitsrelevante Ausrüstung wird für die Verwendung im gewerblichen Bereich eine automatisch wirkende kombinierte Überdruck-Unterdruck-Sicherheitsabsperreinrichtung (OPSO/UPSO) empfohlen. Bei der Verwendung dieser Druckregeleinrichtungen im Arbeitsraum muss eine Abblaseleitung ins Freie verlegt werden.
Zusätzlich darf für die Verwendung im Freien für den Betriebsdruck von 0,05 bar (50 mbar) ein Druckentlastungsventil (DEV) nach Anhang C, DIN 4811 eingebaut sein.
Beispiele der möglichen Anlageninstallation sind gezeigt
- in der Abbildung 40 unter 6.6 Prüfung einer Flüssiggasanlage mit nicht überwachungsbedürftigen Rohrleitungen der Versorgungsanlage und der
- Abbildung 41 unter 6.7 Prüfung einer Flüssiggasanlage mit überwachungsbedürftigen Rohrleitungen der Versorgungsanlage nach Anhang 2 Abschnitt 4 BetrSichV.
5.1.6.4 Druckregeleinrichtungen in Mitteldruckanlagen mit ortsfestem Druckgasbehälter
Bei der Entnahme von Flüssiggas aus einem ortsfesten Druckgasbehälter mit ungeregeltem Eingangsdruck und einem festen oder einstellbaren Ausgangsdruck bis 4 bar ist die DIN 4811 Abschnitt 4.5 zu beachten. Die Nennansprechdrücke von OPSO und PRV sind in den Tabellen 2 bzw. 7 der DIN 4811 festgelegt.
An einer Druckregeleinrichtung mit einem verstellbaren Ausgangsdruck muss zur reproduzierbaren Einstellung und Anzeige des eingestellten Betriebsdrucks entweder eine Zahlenskala oder ein Manometer vorhanden sein.
5.1.7 Rohrleitungen
Fest verlegte Rohrleitungen sind vorrangig vor Schlauchleitungen zu verwenden. Die Unternehmerin oder der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die Verbrauchseinrichtungen nur unter Verwendung geeigneter Rohrleitungen an Versorgungsanlagen angeschlossen werden. Das beinhaltet die Auswahl der Werkstoffe, Dichtwerkstoffe und weiterer Ausrüstungsteile:
- Rohrleitungen müssen aus geeigneten Materialien und Verbindungen bestehen, damit sie für den jeweiligen Anwendungsfall und unter Berücksichtigung der Einsatzbedingungen geeignet sind. Geeignete Materialien sind z. B. Kupfer, Stahl und Edelstahl. Bei Erfordernis sind korrosionsgeschützte Rohrleitungen zu verwenden.
- Bevorzugte Verbindungen sind z. B. für Stahl- und Edelstahlrohrleitungen Schweißverbindungen, sowie für Kupferrohrleitungen Hartlötverbindungen.
- Es können auch andere geeignete Materialien und Verbindungsmöglichkeiten genutzt werden, die für den jeweiligen Anwendungsfall der "Technischen Regel Flüssiggas" (TRF 2021) oder dem "AD 2000" (Regelwerk der Arbeitsgemeinschaft Druckgeräte) entnommen werden können.
Folgende Anforderungen sind zu erfüllen:
- Zur Vermeidung eines nichtbestimmungsgemäßen Gasaustrittes bei Niederdruckanlagen gilt für ortsfeste Flüssiggasanlagen sowie für Großflaschenanlagen (> 16 kg Füllgewicht), deren fest verlegte Rohrleitung durch die Gebäudewand oder Decke geführt wird, folgende Regelung:
Die Rohrleitung der Flüssiggasanlage muss über eine technische Einrichtung verfügen, die im Falle des nichtbestimmungsgemäßen Gasaustrittes aus der Rohrleitung, z. B. bei einer mechanischen Beschädigung der Rohrleitung, selbstständig dafür sorgt, dass der Gasdurchfluss gesperrt wird. Damit ein größtmöglicher Schutz gegen einen nichtbestimmungsgemäßen Gasaustritt aus der gesamten Niederdruck-Rohrleitung der Flüssiggasanlage gewährleistet ist, sollte die Installation dieser technischen Einrichtung direkt am Anfang der Niederdruck-Rohrleitung erfolgen. Hierbei gelten die in der TRF 2021 genannten Grenzen der Eingangsbelastung und Streckenbelastungen.
Bei der Auswahl der Ausrüstungsteile ist der Stand der Technik zu beachten, gegebenenfalls ist eine anlagenspezifische fachkundige Beratung notwendig. Die gewählte technische Maßnahme gegen den nichtbestimmungsgemäßen Gasaustritt ist in der Gefährdungsbeurteilung zu dokumentieren. - Zwischen Versorgungsanlage und Verbrauchseinrichtungen müssen Rohrleitungen so verlegt werden, dass sie gegen chemische, thermische und mechanische Beschädigungen von außen geschützt sind und eine dauerhafte Dichtheit sichergestellt ist. Muss mit mechanischen Einwirkungen gerechnet werden, z. B. infolge von Verkehrs- und Transportvorgängen im Aufstellungsbereich der Flüssiggasanlage, so ist die Versorgungsanlage durch einen stabilen Anfahrschutz zu schützen.
- Nur beim Vorliegen besonderer betriebstechnischer Gründe (siehe 5.1.8 Schlauchleitungen/Sicherungen bei Schlauchbeschädigungen) und nach entsprechender Abwägung im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung dürfen anstelle von fest verlegten Rohrleitungen auch Schlauchleitungen verwendet werden, z. B. bei der Verwendung von Flüssiggas
- auf Baustellen,
- in der Gastronomie,
- bei Fliegenden Bauten (z. B. auf Zirkusveranstaltungen, Volksfesten und Märkten) oder
- in Laboratorien sowie naturwissenschaftlichen Unterrichtsräumen in Schulen.
Durch die Aufstellung an wechselnden Standorten ist wegen der unterschiedlichen Betriebsverhältnisse – ständiger Auf- und Abbau – die Verlegung fester Rohrleitungen nicht immer möglich bzw. sicherheitstechnisch nicht sinnvoll.
Besondere betriebstechnische Gründe können auch vorliegen bei- Verbrauchsanlagen, die sich bestimmungsgemäß bewegen, z. B. Brennerbewegungen,
- Verbrauchsanlagen oder -einrichtungen, die Schwingungen, Vibrationen, Erschütterungen ausgesetzt sind,
- kippbaren oder anhebbaren Fahrzeugaufbauten.
Mit Schwingungen, Vibrationen, Erschütterungen ist z. B. bei folgenden Verbrauchseinrichtungen zu rechnen:- Flämmanlagen, Abflämm- und Enthaarungsmaschinen,
- Vorwärmgeräte für Straßenbeläge.
- Ortsfeste Verbrauchseinrichtungen dürfen nur betrieben werden, wenn sie an fest verlegten Rohrleitungen der Verbrauchsanlage angeschlossen sind. Unter einem festen Anschluss wird z. B. auch ein Anschluss mittels gewellten Metallschlauchleitungen für brennbare Gase nach DIN EN 16617 verstanden. Flüssiggasanlagen in Fahrzeugen dürfen nur dann mit gewellten Metallschlauchleitungen für brennbare Gase nach DIN EN 16617 angeschlossen werden, wenn der Hersteller die bestimmungsgemäße Verwendung hierfür freigegeben hat.
- Abweichend von Absatz 4 dürfen ortsfeste Verbrauchseinrichtungen auch lösbar angeschlossen werden, wenn dies aus betriebstechnischen Gründen notwendig ist, z. B. wenn
- ortsfeste Verbrauchseinrichtungen aus hygienischen bzw. reinigungstechnischen Gründen häufiger umgestellt werden müssen oder wenn
- Verbrauchseinrichtungen an wechselnden Standorten, z. B. auf Baustellen, in Baustellenunterkünften oder in Fliegenden Bauten,
- Brenner in Laboratorien sowie naturwissenschaftlichen Unterrichtsräumen in Schulen
Unter einem lösbaren Anschluss wird z. B. bei Verbrauchsanlagen mit einem Betriebsdruck von 50 mbar die sicherheitstechnische Anschlussarmatur und die Sicherheits-Schlauchleitung mit Anschlussstecker nach DIN 3383-1 "Anschluss von Gasgeräten – Teil 1: Gassteckdosen, Sicherheits-Gasschlauchleitungen" verstanden. - Anschlüsse nach den Absätzen 4 und 5 dürfen durch den Betrieb der ortsfesten Verbrauchseinrichtungen nicht Temperaturen über 40 °C ausgesetzt werden. Anschlüsse dürfen nicht von heißen Abgasen berührt werden.
- Lösbare Rohrleitungsverbindungen, die dynamisch beansprucht werden, müssen freiliegend verlegt werden.
- Die Rohrleitungen sind vor dem erstmaligen Anschließen gefahrlos durch Ausblasen zu reinigen. Für das Ausblasen sollten Luft bzw. Stickstoff verwendet werden. Sofern Stickstoff verwendet wird, muss dieser gefahrlos ins Freie abgeleitet werden.
- Muss aus besonderen betrieblichen Gründen Flüssiggas zum Ausblasen verwendet werden, muss sichergestellt sein, dass austretendes Gas bzw. Gas-Luft-Gemisch gefahrlos ins Freie abgeleitet wird.
- Während der Entlüftung von Rohrleitungen sind die Gase über einen Schlauch gefahrlos ins Freie abzuleiten. Erfolgt die Entlüftung von Rohrleitungen aus besonderen betrieblichen Gründen in Aufstellungsräumen, muss mit einem geeigneten Gas-Messgerät festgestellt werden, ob gegebenenfalls explosionsfähige Atmosphäre vorliegt.
- Die Unternehmerin oder der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass bei absperrbaren Rohrleitungen oder Rohrleitungsabschnitten kein Gas in flüssigem Zustand eingeschlossen werden kann.
- Bei Verdampfern sind die Anforderungen der TRBS 3146/TRGS 746 einzuhalten.
- Nach der Demontage einer Verbrauchseinrichtung ist die nicht mehr verwendete Anschlussstelle der Rohrleitung sicher zu verwahren. Anschließend ist die Rohrleitung auf Dichtheit durch eine zur Prüfung befähigte Person für Flüssiggasanlagen zu prüfen (siehe 6 Prüfungen und Prüffristen von Flüssiggasanlagen zu Brennzwecken).
Erstellung von Rohrleitungen ≤ 0,5 bar
Bei der Erstellung von Rohrleitungen mit einem maximal zulässigen Druck PS ≤ 0,5 bar kann auf Inhalte der "Technischen Regel Flüssiggas" (TRF 2021) zurückgegriffen werden, sofern in dieser DGUV Regel keine anderen oder erweiterten Anforderungen genannt werden. Der Verweis auf die TRF gilt nicht für gewerblich genutzte Fahrzeuge (siehe 5.2.8 Flüssiggasanlagen zu Brennzwecken in oder an Fahrzeugen).
Erstellung von Rohrleitungen > 0,5 bar
Bei der Erstellung von Rohrleitungen mit einem maximal zulässigen Druck PS > 0,5 bar sind die Regelungen der Richtlinie 2014/68/EU "Druckgeräterichtlinie" zu beachten.
Prüfungen von Rohrleitungen
Die Unternehmerin oder der Unternehmer hat in der Gefährdungsbeurteilung nach § 3 (6) Betriebssicherheitsverordnung Prüfinhalte, Prüfzuständigkeiten und Prüffristen der Rohrleitungen festzulegen (siehe 6 Prüfungen und Prüffristen von Flüssiggasanlagen zu Brennzwecken).
5.1.8 Schlauchleitungen/Sicherungen bei Schlauchbeschädigungen
Abweichend von der Regelung gemäß 5.1.7 Rohrleitungen – festverlegte Rohrleitungen sind vorrangig vor Schlauchleitungen zu verwenden – dürfen bei ortsveränderlichen Flüssiggasanlagen oder beim Vorliegen besonderer betriebstechnischer Gründe auch Schlauchleitungen zur Installation von Flüssiggasanlagen verwendet werden.
Besondere betriebstechnische Gründe können vorliegen bei der Verwendung von Flüssiggas für
- Fliegende Bauten, z. B. auf Zirkusveranstaltungen, Volksfesten und Märkten,
- Baustellen,
- Laboratorien und Schulen,
- Verbrauchsanlagen, die sich bestimmungsgemäß bewegen, z. B. Brennerbewegungen, sowie Schwingungen, Vibrationen und Erschütterungen ausgesetzt sind, z. B. Vorwärmgeräte für Straßenbeläge,
- kippbare oder anhebbare Fahrzeugbauten,
- ausziehbare Fahrzeugteile (Slide-Outs),
- Verbrauchseinrichtungen, die aus hygienischen oder reinigungstechnischen Gründen häufiger umgestellt werden müssen, z. B. Verbrauchseinrichtungen in der Gastronomie,
- handgeführte Verbrauchsgeräte, z. B. Lötanlagen.
Grundsätzlich gilt für die Verlegung von Schlauchleitungen:
- die Schlauchleitungen so kurz wie möglich, aber so lang wie nötig ausführen,
- keine Verlegung durch Decken, Wanddurchlässe, um scharfe Kanten herum, etc.
- Schlauchleitungen nicht knicken, stauchen oder verdrehen; Scheuerstellen vermeiden,
- Schlauchleitungen so anschließen, dass die Schlauchanschlüsse nicht unzulässig mechanisch und thermisch belastet werden.
Zu den grundsätzlichen Sicherheitsmaßnahmen gehört außerdem:
- bei Aufstellung über Erdgleiche:
die Verwendung von Schlauchbruchsicherungen nach DIN 30693 oder die Verwendung von Druckregeleinrichtungen mit integrierter Schlauchbruchsicherung nach DIN EN 16129. - bei Aufstellung unter Erdgleiche:
die Verwendung von Leckgassicherungen nach DIN 4811 in Verbindung mit doppelwandigen Schlauchleitungen nach DIN 4815-6 bei Mitteldruckanlagen, die schon bei kleinen Schlauchbeschädigungen (Leckgasmengen) die Gaszufuhr abstellen.
Folgende Anforderungen sind zu erfüllen:
- Es ist dafür zu sorgen, dass Schlauchleitungen, Schlauchanschlüsse und Schlauchverbindungen verwendet werden, die einen dichten Anschluss gewährleisten und so ausgeführt sind, dass sie sich nicht unbeabsichtigt lösen können.
- Es dürfen nur Schlauchleitungen verwendet werden, die gegen die Einwirkungen von Flüssiggas in gasförmiger oder flüssiger Phase beständig sind. Schlauchleitungen nach der Klasse 1 dürfen nicht verwendet werden, da sie nur für einen maximalen Betriebsdruck von 0,2 bar ausgelegt sind.
- Bei Einsatz zwischen Druckregeleinrichtung und Verbrauchseinrichtung müssen die Schlauchleitungen dem maximalen Ausgangsdruck der Druckregeleinrichtung entsprechend ausgelegt sein (mindestens Klasse 2, maximaler Betriebsdruck 10 bar).
- Bei Einsatz zwischen Ventil der Flüssiggasflasche und Druckregeleinrichtung müssen die Schlauchleitungen entsprechend dem Druck der Hochdruckseite ausgelegt sein (Klasse 3, maximaler Betriebsdruck 30 bar).
- Das Datum der Herstellung und die vom Hersteller angegebene Verwendungsdauer der Schlauchleitung (siehe 5.1.16 Instandhaltung) ist zu beachten.
Ausschließlich für die Anwendung von Gasbrennern/Bunsenbrennern in Laboratorien und Schulen sind Schläuche nach DIN 30664-1 zu verwenden. Wenn diese Schläuche nicht festeingebunden sind, z. B. nicht über Endmuffen/Griffmuffen verfügen, bzw. wenn Meterware verwendet wird, sind sie mit Schlauchklemmen gegen unbeabsichtigtes Abrutschen von den Tüllen zu sichern.
Grundsätzlich dürfen selbst eingebundene Schlauchleitungen mit Schlauchtüllen und Schlauchklemmen nicht verwendet werden (siehe DIN EN 16436-2 (Tabelle A.2)). - Schlauchleitungen nach DIN EN 16436-2 sowie Schlauchleitungen aus nicht rostendem Stahl nach DIN EN 16617 mit ihren entsprechend genannten Druckanforderungen sind für den Betrieb mit Flüssiggas in der gasförmigen Phase geeignet.
- Für Treibgasanlagen in Fahrzeugen sind Schlauchleitungen nach DIN 4815-4 zu verwenden.
- Bei der Verwendung von Bunsenbrennern sind Schläuche nach DIN 30664-1 einzusetzen.
- Bei besonderen Bedingungen, z. B. Verklemmungsgefahr bei Bauarbeiten oder Verlegung in Werkstätten, sind nur solche Schlauchanschlusskupplungen einzusetzen, die sich auch bei Verklemmung nicht unbeabsichtigt lösen.

Abb. 27 Schlauchleitung Klasse 3 für maximalen Betriebsdruck 30 bar
- Es dürfen grundsätzlich nur Schlauchleitungen mit einer Länge von maximal 0,4 m verwendet werden.
Ist der Einsatz von längeren Schlauchleitungen unvermeidbar, so dürfen diese nur an Verbrauchseinrichtungen angeschlossen werden, wenn besondere betriebstechnische Gründe vorliegen und die folgenden Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden:- die Verwendung einer auf den Betriebsdruck abgestimmten Schlauchbruchsicherung (SBS) als Maßnahme gegen Gasaustritt bei Schlauchbeschädigungen,
- eine gegen Beschädigung besonders geschützte Schlauchverlegung, z. B. Überfahrschutz, Anfahrschutz, Abdeckungen,
- bei Fliegenden Bauten eine für die Leckkontrolle zugängliche und gegen die mutwillige Beschädigung durch Dritte geschützte Verlegung von Schlauchleitungen,
- die sichtbare Verlegung von Schlauchleitungen bei der Verwendung von Bunsenbrennern als besondere Sicherheitsmaßnahme.
- Schlauchleitungen und Schlauchverbindungen müssen so verlegt werden, dass sie gegen Beanspruchungen geschützt sind oder, wenn dies nicht möglich ist, durch zusätzliche Isolierung gegen zu erwartende Beanspruchungen geschützt werden. Beanspruchungen können mechanische Beschädigungen sowie thermische und chemische Einwirkungen von außen sein.
Mechanische Beschädigungen sind unter anderem zu erwarten, wenn- Schlauchleitungen im Bereich von Verkehrswegen verlegt werden müssen,
- es nicht vermieden werden kann, Schlauchleitungen über scharfe Kanten zu ziehen,
- mit dem Herabfallen von Gegenständen zu rechnen ist.
Zu den unzulässigen thermischen Einwirkungen zählen z. B.:- offene Flammen,
- Strahlungswärme,
- Berührung mit heißen Oberflächen,
- herabfallende heiße Massen, z. B. Bitumen.
Zu den unzulässigen chemischen Beanspruchungen zählen z. B. die Einwirkung von- Fetten, Ölen,
- sauren und basischen Stoffen.
- Die Schlauchleitungen sind vor dem erstmaligen Anschließen gefahrlos durch Ausblasen zu reinigen. Für das Ausblasen sollten Luft bzw. Stickstoff verwendet werden. Sofern Stickstoff verwendet wird, muss dieser gefahrlos ins Freie abgeleitet werden.
- Muss aus besonderen betrieblichen Gründen, z. B. bei der Reinigung von Schlauchleitungen, Flüssiggas zum Ausblasen verwendet werden, muss sichergestellt sein, dass austretendes Gas bzw. Gas-Luft-Gemisch gefahrlos ins Freie abgeleitet wird.
- Während der Entlüftung von Schlauchleitungen sind die Gase über einen Schlauch gefahrlos ins Freie abzuleiten. Erfolgt die Entlüftung von Schlauchleitungen im Ausnahmefall in Aufstellungsräumen, muss mit einem geeigneten Gas-Messgerät festgestellt werden, ob gegebenenfalls eine explosionsfähige Atmosphäre vorliegt.
- Schlauchverbindungen dürfen nicht unzulässig mechanisch belastet werden. Diese Forderung schließt ein, dass die Schlauchverbindung zwischen der Druckregeleinrichtung und der fest verlegten Rohrleitung, z. B. beim Flaschenwechsel, durch das Gewicht der Druckregeleinrichtung oder der Flasche nicht belastet werden darf. Diese Forderung kann z. B. durch Verwendung von Stützvorrichtungen in Form von Konsolen oder Haltevorrichtungen für die Druckregeleinrichtung erfüllt werden.
- Schadhafte Schlauchleitungen dürfen nicht verwendet werden. Auch poröse, brüchige oder aufgequollene Schlauchleitungen gelten als schadhaft. Es ist dafür zu sorgen, dass schadhafte Schlauchleitungen ausgetauscht und anschließend die gelösten Verbindungen auf Dichtheit durch eine zur Prüfung befähigte Person für Flüssiggasanlagen geprüft werden. Abweichend hiervon darf bei Austausch von identischen oder baugleichen Schlauchleitungen die Kontrolle auf Dichtheit durch besonders von Unternehmerinnen und Unternehmern unterwiesene fachkundige Beschäftigte erfolgen (siehe 5.1.16 Instandhaltung).
- Handschrumpfgeräte dürfen nur über Schlauchleitungen, die nicht länger als 8 m sind, an Versorgungsanlagen angeschlossen werden.
- Beim Betrieb von Verbrauchsanlagen, in denen Schlauchleitungen verwendet werden, die besonderen chemischen, thermischen und mechanischen Beanspruchungen unterliegen, sind die im Absatz 2 genannten Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, die verhindern, dass bei einer Schlauchleitungsbeschädigung Gas in gefahrdrohender Menge entweichen kann.

Besondere chemische, thermische oder mechanische Beanspruchungen liegen vor, wenn Schlauchleitungen z. B. - aggressiven Medien ausgesetzt sind,
- in Berührung mit heißen Teilen, Gasen oder Brennerflammen kommen können,
- Biegewechselbeanspruchungen ausgesetzt sind,
- geknickt oder überfahren werden können.
Bei den nachfolgenden beispielhaft genannten Arbeiten sollte mit besonderen Beanspruchungen gerechnet werden:- Bauarbeiten,
- Schaustellerarbeiten,
- Arbeiten mit Handschrumpfgeräten,
- Arbeiten in Schlacht- und Fleischverarbeitungsbetrieben.
Schlauchleitungen bis 0,4 m Länge zwischen Versorgungsanlagen und fest verlegten Rohrleitungen sowie zwischen fest verlegten Rohrleitungen und ortsfesten Verbrauchseinrichtungen sind in der Regel keinen besonderen chemischen, thermischen oder mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt.
Prüfungen von Schlauchleitungen
Schlauchleitungen werden hinsichtlich ihrer Prüfzuständigkeiten und Prüfungshöchstfristen entsprechend Betriebssicherheitsverordnung wie Rohrleitungen angesehen. Prüfinhalte und Prüffristen müssen aber die speziellen Eigenschaften von Schlauchleitungen berücksichtigen. Siehe hierzu 5.1.7 Rohrleitungen und 6 Prüfungen und Prüffristen von Flüssiggasanlagen zu Brennzwecken.
5.1.9 Betreiben von Verbrauchsanlagen
Die Unternehmerin oder der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass nur Verbrauchseinrichtungen in Betrieb genommen werden, die den zu erwartenden chemischen, thermischen und mechanischen Beanspruchungen insoweit genügen, dass bei deren Betrieb Beschäftigte nicht gefährdet werden.
| Bei Verbrauchseinrichtungen, die unter den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2016/426 über Geräte zur Verbrennung gasförmiger Brennstoffe fallen und deren Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Verordnung der Hersteller/ Inverkehrbringer durch eine EU-Konformitätserklärung nach Artikel 15 und durch Anbringung des CE-Zeichens nach Artikel 7 der Verordnung nachgewiesen hat, gelten diese Voraussetzungen bei bestimmungsgemäßer Verwendung als erfüllt. Insbesondere müssen die Verbrauchseinrichtungen den wesentlichen Anforderungen gemäß Anhang 1 der genannten Verordnung entsprechen. |
Verbrauchseinrichtungen, die vor dem 01.01.1996 in Verkehr gebracht wurden, müssen eine DVGW-Zulassung haben (DVGW – Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.). Verbrauchseinrichtungen ohne CE-Kennzeichnung bzw. DVGW-Zulassung dürfen in der Europäischen Gemeinschaft bzw. Bundesrepublik Deutschland nicht eingesetzt werden.
Zusätzlich zur Anbringung der CE-Kennzeichnung auf der Verbrauchseinrichtung ist der Hersteller verpflichtet, in deutscher Sprache
- eine Anleitung für Installateure und Installateurinnen sowie eine Bedienungs- und Wartungsanleitung für Benutzer und Benutzerinnen beizufügen und
- auf dem Gerät sowie auf dessen Verpackung die erforderlichen Warnhinweise anzubringen.
Unabhängig von vorliegender EU-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung ist für die Flüssiggasanlage und damit auch für die Verbrauchsanlage eine Gefährdungsbeurteilung entsprechend § 3 BetrSichV durchzuführen.
Anlagen bzw. Ausrüstungsteile, z. B. Druckregeleinrichtungen, Sicherheitsventile und Schlauchbruchsicherungen, müssen auf die Anschlusswerte der Verbrauchseinrichtungen abgestimmt sein.

Abb. 28: Beispielhafte Abbildung eines Typenschilds mit Aufschriften
Vor der erstmaligen Inbetriebnahme von Flüssiggasanlagen, deren Prüfung nach § 14 BetrSichV als Arbeitsmittel geregelt ist, muss eine zur Prüfung befähigte Person für Flüssiggasanlagen mit der Durchführung einer Prüfung beauftragt werden (siehe 6 Prüfungen und Prüffristen von Flüssiggasanlagen zu Brennzwecken). Bei der kurzzeitigen Inbetriebnahme von Flüssiggas-Versuchsanlagen im Kleinstmaßstab für Forschungs-, Lehr- bzw. Unterrichtszwecke ist vor Inbetriebnahme eine Gefährdungsbeurteilung sowie Dichtheitskontrolle durch eine fachkundige Person vorzunehmen.
- Verbrauchseinrichtungen dürfen nur betrieben werden, wenn gefährliche Ansammlungen von unverbranntem Gas vermieden werden.
Dies ist durch den Betrieb einer Verbrauchseinrichtung mit Flammenüberwachung gewährleistet, z. B. mittels einer thermoelektrischen Zündsicherung. Dies gilt auch für Verbrauchseinrichtungen, die im Freien betrieben werden.
Außerdem ist diese Anforderung erfüllt, wenn- bei Verbrauchseinrichtungen mit mehreren Brennern die Brenner so zueinander angeordnet sind, dass eine sichere Überzündung gewährleistet ist. Mindestens ein Brenner muss mit einer Flammenüberwachung und zusätzlich mit einer dauernd wirkenden Zündeinrichtung, z. B. Zündbrenner oder Zündfunken, ausgerüstet sein, deren Funktion so überwacht werden muss, dass im Störungsfall die Sicherheitsabschaltung aller Brenner bewirkt wird.
- bei Industrieöfen, die im Langzeitbetrieb und kontinuierlich mit einer Arbeitstemperatur über 650 °C betrieben werden
- beim Anheizvorgang,
- bei Arbeitstemperaturen unter 650 °C,
- in Ofenzonen unter 650 °C Arbeitstemperatur
Langzeitbetrieb bei Öfen liegt dann vor, wenn die arbeitsablaufbedingte Betriebsphase (Zeit zwischen Anheizen und Abstellen des Ofens) 7 Tage überschreitet. Langzeitbetrieb kann vorliegen z. B. bei Öfen der Glas- und Keramikindustrie.
Kontinuierlich werden Öfen dann betrieben, wenn die im Ofen zu behandelnden Produkte ohne Unterbrechung des Arbeitsablaufes in den Ofen eingebracht, während des Erwärmens durch den Ofen gefördert und aus dem Ofenraum ausgetragen werden.
Die Arbeitstemperatur ist die Temperatur, die zur Durchführung eines bestimmten Wärmevorganges benötigt wird. Je nach Konstruktion oder Betriebsweise können bereichs- oder zeitweise unterschiedliche Arbeitstemperaturen vorliegen. Für eine sichere Zündung ist die Wandungstemperatur im Brennraum maßgebend. Die Arbeitstemperatur muss nicht mit der Temperatur des Arbeitsgutes identisch sein. - Handbrenner, Flämmgeräte und gleichartige Verbrauchseinrichtungen benutzt werden, bei denen Flammenstabilität gewährleistet ist und die beim Arbeitsvorgang ständig beobachtet werden.

Weiterführende Informationen zu Flammenüberwachungen - DIN EN 125: "Flammenüberwachungseinrichtungen für Gasgeräte – Thermoelektrische Zündsicherungen"
- DIN EN 298 "Feuerungsautomaten für Gasbrenner und Gasgeräte mit und ohne Gebläse"
- DIN EN 676 "Automatische Brenner mit Gebläse für gasförmige Brennstoffe"
- Verbrauchsanlagen dürfen nur mit einem gleichmäßigen, auf die Verbrauchseinrichtungen abgestimmten Betriebsdruck betrieben werden.
Ein gleichmäßiger Betriebsdruck kann z. B. gewährleistet werden durch die Verwendung einer Druckregeleinrichtung entsprechend 5.1.6.1 Druckregeleinrichtungen in Niederdruckanlagen mit Flüssiggasflaschen,- die unmittelbar am Flaschenventil (HAE) installiert wird und
- deren Betriebsdruck auf die Verbrauchseinrichtung abgestimmt ist.
- bei Verbrauchsanlagen, die aus Einwegbehältern versorgt werden,
- bei Verbrauchsanlagen, denen das Gas bestimmungsgemäß flüssig zugeführt wird, wenn diese Anlagen mit geeigneten Einrichtungen ausgerüstet sind, die einen konstanten Betriebsdruck gewährleisten, z. B. mit einer Druckregeleinrichtung für flüssige und gasförmige Anwendungen sowie mit einem entsprechendem Verdampfungsbrenner,
- wenn an der Hauptabsperreinrichtung bereits der Betriebsdruck ansteht.
Wird eine Sicherheits-, Regel- und Absperreinrichtung mit Hilfsenergie betrieben, so muss gemäß Anhang I der Verordnung (EU) 2016/426- bei normaler Schwankung der Hilfsenergie die Verbrauchseinrichtung weiterhin sicher funktionieren und
- bei unzulässiger Schwankung oder Ausfall der Hilfsenergie die Gaszufuhr zu den Brennern der Verbrauchseinrichtung zwangsläufig absperren.
Druckregeleinrichtungen haben die Aufgabe, ihren Ausgangsdruck innerhalb der festgelegten Grenzen konstant zu halten.

Weiterführende Informationen zu Druckregeleinrichtungen - DIN 4811 "Flüssiggasdruckregelgeräte und Sicherheitseinrichtungen – Anforderungen"
- DIN EN 16129 "Druckregelgeräte, automatische Umschaltanlagen mit einem höchsten Ausgangsdruck bis einschließlich 4 bar und einem maximalen Durchfluss von 150 kg/h sowie die dazugehörigen Sicherheitseinrichtungen und Übergangsstücke für Butan, Propan und deren Gemische"
- Bei Verbrauchsanlagen, bei denen die Verbrauchseinrichtungen nicht dem ungeregelten Druck standhalten, müssen Einrichtungen gegen unzulässig hohen Druckanstieg verwendet werden.
Ein unzulässig hoher Druckanstieg kann z. B. verhindert werden durch die Verwendung von Sicherheitseinrichtungen entsprechend 5.1.6.1 Druckregeleinrichtungen in Niederdruckanlagen mit Flüssiggasflaschen. Für andere Anwendungen siehe 5.1.6.2 bis 5.1.6.4. - Verbrauchsanlagen müssen so betrieben werden, dass eine Brandgefahr verhindert ist und Verbrennungen oder Verbrühungen vermieden werden, siehe 5.1.15 Brandschutz bei Flüssiggasanlagen.
- Die Unternehmerin oder der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass nur Verbrauchseinrichtungen betrieben werden, bei denen das Zünden sicher erfolgen kann und Flammen weder zurückschlagen noch abheben können. Diese Forderung beinhaltet, dass das Ausströmen von Gas in jedem Betriebszustand begrenzt ist, damit eine gefährliche Ansammlung von unverbranntem Gas in dem Gerät verhindert wird (siehe Anhang I der Verordnung (EU) 2016/426).
- Brenner müssen auf sichere Art gezündet werden. Hierzu müssen von der Unternehmerin oder dem Unternehmer geeignete Gasanzünder zur Verfügung gestellt werden.
Zum sicheren Zünden gehören- das Verwenden von Verbrauchseinrichtungen mit fest installierten Zündeinrichtungen, z. B. Piezozünder,
- die Benutzung vorhandener Zündeinrichtungen, die in den Sicherheitskreis der Flammenüberwachung einbezogen sind,
- die Einhaltung von Zündpausen und eventuellen Spülvorgängen bei wiederholten Zündvorgängen,
- das Verwenden geeigneter Gasanzünder, z. B. Zündlanzen.
- Bei zwangsluftbetriebenen Brennern von Verbrauchseinrichtungen muss bei Druckabfall oder Ausfall der Verbrennungsluft die Gaszufuhr abgesperrt werden. Dies kann z. B. durch eine Einrichtung gewährleistet werden, die
- in der Verbrauchseinrichtung integriert oder
- der Verbrauchseinrichtung vorgeschaltet ist.
- Verbrauchseinrichtungen, in denen Heißluft oder Verbrennungsgase umgewälzt oder aus denen Abgase mechanisch abgesaugt werden, müssen so betrieben werden, dass beim Ausfall der Umwälz- oder Abgasanlagen die Gaszufuhr zu den Brennern abgeschaltet wird.
- Bei Verbrauchseinrichtungen, die gleichzeitig mit verschiedenen brennbaren oder die Verbrennung fördernden Gasen gespeist werden können, muss die Unternehmerin oder der Unternehmer dafür sorgen, dass eine Gas-Art nicht in die Rohrleitung der anderen Gas-Art eindringen kann.
- Verbrauchseinrichtungen dürfen nur aus der Gasphase betrieben werden. Dies gilt nicht für Verbrauchseinrichtungen, die für den Betrieb aus der Flüssigphase konstruiert sind.
- Bei Betrieb aus der Gasphase muss sichergestellt sein, dass in den Rohrleitungen keine Rückkondensation erfolgen kann. Abhängig von den zu erwartenden niedrigsten Umgebungstemperaturen, denen die Rohrleitungen ausgesetzt sind, kann dies durch entsprechende Druckregelung bzw. -begrenzung unter Berücksichtigung des Gases (Propan, Butan oder Propan-Butan-Gemisch) und dessen druckabhängigem Taupunkt erfolgen. Der Druck ist so zu wählen, dass die minimal auftretende Gastemperatur immer größer als der gegebene Taupunkt ist. Kann dies nicht sichergestellt werden, sind Rohrleitungen gegebenenfalls zu beheizen und/oder zu isolieren.
- Verbrauchseinrichtungen müssen so betrieben werden, dass die Verbrennung einwandfrei ist und die Flammenstabilität gewährleistet ist. Eine einwandfreie Verbrennung liegt vor, wenn z. B. bei geschlossenem Brennraum der CO-Gehalt im unverdünnten Abgas 0,1 Vol.-% nicht übersteigt.
Bei Benutzung von Verbrauchseinrichtungen in Räumen, Kellern und Gräben ist die Einhaltung der geltenden Arbeitsplatzgrenzwerte zu beachten und gegebenenfalls zu überwachen (siehe hierzu TRGS 402 und 900).
Eine einwandfreie Verbrennung liegt auch vor, wenn verfahrenstechnisch bedingt temporär mit sauerstoffreduzierter Atmosphäre gearbeitet werden muss und geeignete Sicherheitsmaßnahmen (z. B. Absperrmaßnahmen) getroffen sind.
Diese Anforderung beinhaltet, dass verschmutzte Brenner zu reinigen sind. - Nur solche Verbrauchseinrichtungen dürfen verwendet werden, bei denen bei unbeabsichtigter Beeinflussung der Primärluft keine gefährliche Flammenänderung eintritt. Diese Forderung ist z. B. bei Handbrennern erfüllt durch
- Bohrungen im Injektor oder
- Ausbildung des Lufteintrittes am Injektorrohr derart, dass eine großflächige Abdeckung, die die Luftzufuhr verhindert, nicht möglich ist.
- Handbrenner müssen bei Arbeitsunterbrechungen sicher abgelegt oder aufgehängt werden. Ein sicheres Ablegen von Handbrennern ist möglich, wenn diese mit einer Ablegevorrichtung (z. B. einer Federstütze) ausgerüstet sind, die so gestaltet ist, dass die Kleinflamme (auch Wachflamme genannt) bei ordnungsgemäßem Ablegen oder Abstellen des Brenners nicht auf die Abstellfläche gerichtet ist. Das Aufhängen oder Ablegen von Handbrennern und Schlauchleitungen an Druckgasbehältern und anderen gasführenden Einrichtungen ist kein sicheres Aufhängen und deshalb verboten.
- Handbrenner mit Flammenkleinstellung müssen so eingestellt werden (Einstellschraube), dass die Kleinflammen auch im Freien stabil brennen. Hinweise zur Windstabilität siehe DIN EN ISO 9012 "Gasschweißgeräte; Handbrenner für angesaugte Luft; Anforderungen und Prüfungen".
- Stellteile von Verbrauchsanlagen sind Elemente zum Verstellen von Steuer- und Regeleinrichtungen. Diese müssen leicht und gefahrlos erreichbar sein und den betriebstechnischen Erfordernissen entsprechend von Stellen betätigt werden können, von denen die zu steuernden Funktionen eingesehen werden können.
"Leicht erreichbar" bedeutet, ohne Behinderung das Stellteil zu erreichen. Diese Forderung beinhaltet,- dass der Zugang zu Stellteilen freigehalten werden muss,
- dass Stellteile von Verbrauchsanlagen in der Fleischwirtschaft nicht im Inneren von Räucherräumen, -kammern oder -türmen angebracht werden.
- Stellteile von Verbrauchsanlagen dürfen nicht unbeabsichtigt betätigt werden können. Unbeabsichtigtes Betätigen von Stellteilen ist z. B. möglich durch Anstoßen, Hängenbleiben mit Kleidung und Fallen von Gegenständen auf Hebelschalter.
Die Forderung nach einem Schutz gegen unbeabsichtigtes Betätigen der Stellteile kann z. B. erfüllt werden durch geeignete Anordnung der Stellteile bzw. Aufstellung der Verbrauchseinrichtungen. - Verbrauchsanlagen dürfen erst von Versorgungsanlagen getrennt werden, wenn sicher gewährleistet ist, dass kein weiterer Gasaustritt erfolgen kann. Dies ist z. B. dadurch zu erreichen, dass bei laufendem Betrieb der Verbrauchseinrichtung das Hauptabsperrventil der Versorgungsanlage abgesperrt wird und das in der Leitung vorhandene Flüssiggas noch sicher verbraucht (verbrannt) wird.
- Verbrauchsanlagen dürfen nur betrieben werden, wenn eine ausreichende Belüftung der Räume, in denen die Verbrauchseinrichtungen aufgestellt sind, gewährleistet ist (siehe 5.1.12 Lüftungseinrichtungen/Abgasleitungen).
5.1.10 Oberflächentemperaturen
Es ist dafür zu sorgen, dass heiße Oberflächen, die nicht unmittelbar für den Arbeitsvorgang erforderlich sind und im Arbeits- und Verkehrsbereich liegen, gegen zufälliges Berühren so gesichert und gekennzeichnet werden, dass Verletzungen verhindert werden. Teile von Verbrauchseinrichtungen, bei denen die Gefahr durch Verbrennung erkennbar ist, benötigen keine gesonderte Kennzeichnung der hohen Oberflächentemperaturen.
| Weiterführende Informationen | |
| Hinsichtlich Oberflächentemperaturen siehe DIN EN ISO 13732-1 "Ergonomie der thermischen Umgebung – Bewertungsverfahren für menschliche Reaktionen bei Kontakt mit Oberflächen – Teil 1: Heiße Oberflächen". | |
Bei einer angenommenen Kontaktdauer zum Material von 1 Sekunde kann die Haut ab einer Oberflächentemperatur von 65 °C Verbrennungen aufweisen.
Bei längeren Kontaktdauern können Verbrennungen schon bei geringeren Oberflächentemperaturen auftreten (siehe Tabelle 5).
Tabelle 5 Verbrennungsschwellen für Kontaktdauern von 1 min und länger
| Material | Verbrennungsschwellen für Kontaktdauern von | |||
| 1 min | 10 min | 8 h und länger | ||
| Unbeschichtete Metalle | 51 °C | 48 °C | 43 °C | |
| Keramische, glas- und steinartige Materialien | 56 °C | 48 °C | 43 °C | |
| Kunststoffe und Holz | 60 °C | 48 °C | 43 °C | |
Quelle: DIN EN ISO 13732-1
Zu den heißen Teilen, bei denen die Gefahr durch Verbrennung besteht, zählen z. B.
- Brennerflansche und Abgasstutzen,
- Ausblashauben von Warmlufterzeugern,
- Brennkammern, Strahlflächen und Abstandsbügel von Heizstrahlern,
- Brennkammern und Gasrückführleitungen von Bautrocknern mit Verdampfungsbrennern,
- Türen von Industrieöfen,
- Reflektoren von Terrassenheizstrahlern.
5.1.11 Kontrolle der Dichtheit/Feststellung von Undichtheiten

Abb. 29 Dichtheitskontrolle mittels Lecksuchspray nach Anschluss der Druckregeleinrichtung an die Flüssiggasflasche
Eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre kann z. B. auftreten
- an Undichtheiten, die durch unsachgemäßen Flaschenwechsel entstehen können,
- an Undichtheiten, bei denen konstruktionsbedingt die Dichtheit während des Betriebes auf Dauer nicht gewährleistet ist, z. B. Flansch mit glatter Dichtleiste und ohne besondere konstruktive Anforderungen an die Dichtung (weitere Beispiele siehe TRGS 722 "Vermeidung oder Einschränkung gefährlicher explosionsfähiger Gemische"),
- betriebsmäßig beim Anschließen und Lösen von Rohrleitungsverbindungen,
- bei Gasaustritt aus Sicherheitseinrichtungen,
- bei Mängeln und Defekten an Ausrüstungsteilen.
Die Unternehmerin oder der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Flüssiggasanlagen vor jeder Verwendung arbeitstäglich kontrolliert werden. Fachkundige Personen dürfen nach Unterweisung die Dichtheitskontrolle sowie die Inaugenscheinnahme auf offensichtliche Mängel durchführen. Zur Unterstützung dienen die von den Herstellern mitgelieferten Unterlagen zu den Ausrüstungsteilen (z. B. Betriebsanleitungen).
Folgende Anforderungen sind zu erfüllen:
- Verbrauchsanlagen dürfen nur betrieben werden, wenn ihre mit Flüssiggas beaufschlagten Anlagenteile bei den chemischen, thermischen und mechanischen Beanspruchungen dicht bleiben, die aufgrund der vorgesehenen Betriebsweise zu erwarten sind.
- Verbrauchsanlagen müssen an Versorgungsanlagen dicht angeschlossen und die Dichtheit muss kontrolliert werden. Die Forderung nach Dichtheit beinhaltet, dass die Anlagen und Ausrüstungsteile einschließlich aller lösbaren und unlösbaren Verbindungen gegenüber der umgebenden Atmosphäre so dicht bleiben, dass an keiner Stelle eine Brand-, Explosions- oder Gesundheitsgefahr entstehen kann.
- Die Dichtheitskontrolle der Anschlussverbindung von der Druckregeleinrichtung zum Druckgasbehälter und weiterer während des Flaschenwechsels mechanisch belasteter Verbindungsstellen der Flüssiggasanlage muss nach jedem Anschluss und vor Wiederinbetriebnahme der Flüssiggasanlage erfolgen, z. B. nach dem Wechsel der Flüssiggasflasche oder bei Aufstellung an einem neuen Standort.
Hierzu wird nach der Herstellung der Anschlussverbindung (Druckregeleinrichtung an Flaschenventil bzw. Hochdruckschlauchleitung an Flaschenventil) diese bei geöffnetem Flaschenventil und in "Nullstellung" befindlichem Mehrfachstellgerät der Verbrauchseinrichtung auf Dichtheit kontrolliert (siehe Abbildung 29).

Die Dichtheitskontrolle an Flüssiggasanlagen kann z. B. erfolgen - mit einem schaumbildenden Mittel, z. B. Lecksuchspray (siehe DIN EN 14291) oder
- mit Lecksuch- oder Anzeigegeräten, durch die eventuell ausströmendes Gas nicht entzündet wird.

Die Dichtheit darf niemals mit offenem Feuer oder anderen Zündquellen kontrolliert werden! - Die Dichtheit des Anschlusses darf nicht durch das Gewicht der Druckregeleinrichtung sowie der Flüssiggasflasche beeinträchtigt werden. Gasführende Teile des Anschlusses dürfen nicht für die Befestigung der Flüssiggasflasche verwendet werden.
- Sofern Verdacht auf Undichtheiten besteht, z. B. durch Gasgeruch, muss die zugehörige Hauptabsperreinrichtung der Flüssiggasanlage unverzüglich geschlossen werden. Mögliche Zündquellen, wie z. B. ein elektrischer Verbraucher, dürfen nicht eingeschaltet werden. Zur Beseitigung von unverbranntem Gas werden in der Regel ins Freie führende Türen und Fenster zur Lüftung geöffnet; Querlüftung ist am wirksamsten. Undichte Flüssiggasflaschen sind, soweit dies gefahrlos möglich ist, aus dem gefährdeten Bereich zu entfernen. Anschließend sind sie zu kennzeichnen, damit sie nicht wiederverwendet werden.
- Druckregeleinrichtungen mit verschlissenen oder beschädigten Dichtungen dürfen nicht angeschlossen werden. Verschlissene oder beschädigte Dichtungen müssen fachkundig ersetzt werden.
- Flüssiggasflaschen mit verschlissenen oder beschädigten Dichtungen sind der Verwendung zu entziehen. Diese müssen durch den Gaslieferanten instandgesetzt werden.
Unabhängig von den oben genannten Kontrollen sind die Prüfungen vor Inbetriebnahme, vor Wiederinbetriebnahme nach prüfpflichtigen Änderungen und die wiederkehrenden Prüfungen von Flüssiggasanlagen entsprechend 6 Prüfungen und Prüffristen von Flüssiggasanlagen zu Brennzwecken durchzuführen.
5.1.12 Lüftungseinrichtungen/Abgasleitungen
Bei der Verbrennung von Flüssiggas besteht die größte Gefahr in der Bildung von giftigem Kohlenmonoxid (CO) durch unvollständige Verbrennung (zu geringe Luftzufuhr) infolge mangelhafter Wartung der Verbrauchseinrichtung (z. B. verstopfte Düsen) und unzureichender Be- und Entlüftung. Außerdem werden bei der Verbrennung große Mengen von Kohlendioxid (CO2) und Wasser freigesetzt.
Diese Stoffe müssen durch eine wirksame Be- und Entlüftung des Arbeitsraumes beseitigt werden.
|
Berechnungsbeispiel: Für die vollständige Verbrennung von 1 kg Flüssiggas werden ca. 15 m³ Verbrennungsluft benötigt. Hierbei entstehen 3 kg CO2 und 1,6 kg Wasser. Um den Arbeitsplatzgrenzwert von CO2 (0,5 Vol. %) als Leitkomponente einhalten zu können, sind pro kg Brenngas ca. 330 m³ Luft (Zu- bzw. Abluftmenge) notwendig. Unter Berücksichtigung des Heizwertes von Propan ergibt sich ein erforderlicher Luftvolumenstrom von 26 m³/h je kW Leistung. Ein freistehender Hockerkocher mit z. B. 12,5 kW Nennwärmebelastung benötigt bei Volllast 325 m³/h Zu- und Abluft. |
Kann dies nicht allein durch natürliche Lüftung, wie z. B. durch Fenster und Türen, gewährleistet werden, so muss mindestens eine Abluftanlage mit freier Nachströmung von Außenluft oder gegebenenfalls auch eine raumlufttechnische Anlage mit Zu- und Abluft vorhanden sein.
Schon vor der Anschaffung der geplanten Gasgeräte (A, B oder C, siehe Begriffsbestimmungen) ist deren Art gegebenenfalls unter Hinzuziehung von Fachleuten festzulegen.
Für den Einsatz von Geräten in Küchenbetrieben sind ferner u. a. die VDI 2052 "Raumlufttechnische Anlagen für Küchen" (VDI-Lüftungsregeln) zu beachten.
Übergeordnet sind die nachfolgenden Anforderungen zu berücksichtigen:
- Räume, in denen Gasgeräte der Arten A und B betrieben werden, sind so zu be- und entlüften, dass in der Raumluft keine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre, keine Anreicherung von Abgasen (insbesondere CO und CO2) und kein Sauerstoffmangel auftreten können.
- Zu erreichen ist dies durch technische Lüftungseinrichtungen (z. B. Dunstabzugshauben). Diese müssen vor Inbetriebnahme der Verbrauchseinrichtungen in Funktion gesetzt werden.
Verpflichtend ist eine Armaturenkombination aus Druckwächter, zentraler Steuereinheit und Magnetventilen, wenn- die Nennwärmebelastung der angeschlossenen Gasgeräte mehr als 14 kW beträgt und
- die Versorgungsanlage so dimensioniert ist, dass sie die notwendige Verdampfungsleistung dauerhaft bereitstellen kann.
Hierbei ist die "Beratungshilfe zur Sicherstellung der Abgasführung von Gasgeräten bei Neuanlagen und bestehenden Anlagen" der BGN zum DVGW Arbeitsblatt G 631 (A) zu berücksichtigen, siehe BGN Branchenwissen, Wissen Kompakt Flüssiggas www.bgn.de/754. - Bei besonders günstigen Verhältnissen kann zu Gunsten einer natürlichen Raumlüftung auf eine technische Lüftungsanlage verzichtet werden. Solche günstigen Verhältnisse können vorliegen, wenn Räume über zwei in unterschiedlicher Höhe angeordnete, ständig offene Lüftungsöffnungen in gegenüberliegenden Wänden verfügen. Dabei muss sich eine Öffnung in Fußbodennähe befinden und die Querschnitte müssen so groß sein, dass ein ausreichender Austausch der Raumluft gewährleistet ist. Eine natürliche Lüftung ist bis zu einer Nennwärmebelastung von 50 kW ausreichend, wenn bei einer Querlüftung jede Öffnungsfläche mindestens 1 % der Bodenfläche groß ist (jedoch nicht kleiner als 100 cm² je Öffnung). Weitere Festlegungen zur Verbrennungsluftversorgung und zur Größe der Lüftungsöffnungen sind u. a. dem § 3 der Musterfeuerungsverordnung zu entnehmen.
- Verbrauchseinrichtungen, die nicht an Abgasanlagen angeschlossen werden müssen und die Verbrennungsluft in den Raum leiten, dürfen nur betrieben werden, wenn
- die Räume gut be- und entlüftet sind und
- der Anteil gesundheitsschädlicher Stoffe (insbesondere CO und CO2) in der Atemluft keine gefährliche Konzentration erreicht.
- Die erforderlichen Mindestquerschnitte der Abgasleitungen sowie der Be- und Entlüftungsöffnungen dürfen nicht verkleinert werden.
Hierzu gehört auch, dass Lüftungsöffnungen- nicht zugestellt und
- regelmäßig gereinigt
| Weitere Informationen | |
|
Erforderliche Mindestquerschnitte von Abgasleitungen siehe: TRF 2021 "Technische Regel Flüssiggas" des DVFG (Deutscher Verband Flüssiggas e. V.)/DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.), sowie die TRGI 2018 "Technische Regel für Gasinstallationen" und die einschlägigen Arbeitsblätter des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.) |
|
5.1.13 Außerbetriebnahme von Verbrauchsanlagen
Die Unternehmerin oder der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die Gaszufuhr zur Verbrauchsanlage bei Außerbetriebnahme, Betriebsruhe sowie im Gefahrfall leicht unterbrochen werden kann, um einen unkontrollierten Gasaustritt zu vermeiden.
Die Gaszufuhr zu den Verbrauchseinrichtungen und zur Verbrauchsanlage muss
- zum Arbeitsschluss
- bei längeren Arbeitsunterbrechungen (z. B. während der üblichen Pausen)
- zur Beendigung des durchgehenden Betriebes
- nach Verbrauch des Flüssiggases
- vor dem Abschrauben der Druckregeleinrichtung
- vor dem Lösen der Rohrleitungen
- bei Störungen oder in Gefahrfällen
unterbrochen werden, z. B. durch Schließen des Flaschenventils oder der Hauptabsperreinrichtung und der Absperreinrichtung vor der Verbrauchseinrichtung. Jede angeschlossene Verbrauchseinrichtung muss für sich einzeln absperrbar sein und zwar am Ende der fest verlegten Rohrleitungen. Die Absperreinrichtungen müssen jederzeit zugänglich sein.
Hierzu gehört auch, dass nach dem Verbrauch des Flüssiggases oder nach dem Abschrauben der Druckregeleinrichtung vom Flaschenventil die Ventilverschlussmutter aufgeschraubt und die Ventilschutzkappe wieder angebracht wird.
Längere Arbeitsunterbrechungen liegen nicht vor, wenn Verbrauchseinrichtungen während der Arbeitsunterbrechungen (z. B. in Pausen) beaufsichtigt weiterbetrieben werden.
Durchgehender Betrieb liegt vor, wenn die arbeitsablaufbedingte Betriebsphase länger als eine Arbeitsschicht dauert. Durchgehender Betrieb kann z. B. an Wochenenden und Feiertagen sowie bei Heiz- und Trocknungsprozessen erforderlich sein.
Bei der Außerbetriebnahme von Flüssiggasanlagen ist zwischen zwei Aufstellungsvarianten (Versorgungsanlage und Verbrauchseinrichtung) zu unterscheiden.
Für beide nachfolgenden Varianten gilt:
Vor jeder Verbrauchsanlage (dies kann eine Verbrauchseinrichtung oder mehrere einzelne Verbrauchseinrichtungen sein) muss eine leicht zugängliche Hauptabsperreinrichtung (HAE) eingebaut sein, mit der ein sofortiges Absperren der gesamten Verbrauchsanlage möglich ist.
| Variante 1: Versorgungsanlage und Verbrauchseinrichtung im selben Raum Sofern sich die gesamte Flüssiggasanlage (Flüssiggasflasche, Rohrleitungen, Gasgerät etc.) im Arbeitsraum befindet, ist die Absperreinrichtung der Versorgungsanlage (z. B. Flaschenventil) als Hauptabsperreinrichtung zur Absperrung der Gaszufuhr zu verwenden. Siehe Abbildung 30.
Abb. 30 Zudrehen des Flaschenventils (Flaschenventil = Hauptabsperreinrichtung, Drehrichtung rechts) |
| Variante 2: Versorgungsanlage und Verbrauchseinrichtung räumlich getrennt Bei räumlicher Trennung der Versorgungsanlage von der Verbrauchseinrichtung (z. B. Versorgungsanlage im Freien, Verbrauchseinrichtung im Arbeitsraum oder Aufstellung der Versorgungsanlage in einem separaten Aufstellungsraum), ist eine Hauptabsperreinrichtung (HAE) unmittelbar vor oder nach dem Eintritt der fest verlegten Rohrleitung in das Gebäude an leicht zugänglicher Stelle zu installieren. Außerdem muss nach Einführung der fest verlegten Rohrleitung in den Arbeitsraum eine thermisch auslösende Absperreinrichtung (TAE) zur automatischen Absperrung der Gaszufuhr im Brandfall installiert sein. Siehe Abbildung 31.
Abb. 31 Flaschenaufstellung im Freien (z. B. im Flaschenschrank)
1 verschließbarer Flaschenschrank |
5.1.14 Innerbetriebliche Beförderung von Flüssiggasanlagen
Folgende Anforderungen sind zu erfüllen:
- Flüssiggasflaschen dürfen nur mit solchen Transporteinrichtungen (z. B. Flaschenwagen) befördert werden, die einen sicheren Transport gewährleisten. Unter Befördern wird das Umsetzen von Flüssiggasflaschen verstanden (siehe TRBS 3145/TRGS 745 "Ortsbewegliche Druckgasbehälter – Füllen, Bereithalten, innerbetriebliche Beförderung, Entleeren").
- Flüssiggasflaschen müssen bei der Beförderung so gesichert werden, dass sie nicht umkippen oder sonst ihre Lage verändern können.
- Vor dem Befördern von Flüssiggasanlagen müssen vorhandene Absperreinrichtungen der Flüssiggasflaschen und der Verbrauchseinrichtungen geschlossen werden sowie der Ventilschutz (z. B. Schutzkappe oder Ventilschutzkorb) angebracht sein.
- Flüssiggasanlagen dürfen nicht mit Ladegütern zusammen befördert werden, die die Sicherheit der Anlagen gefährden, z. B. mit Gütern aus brennbaren Materialien.
| Weitere Informationen | |
| Zur Beachtung der Regelungen für die Beförderung von Flüssiggas auf öffentlichen Straßen siehe ADR "Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße" und DGUV Information 210-001 "Beförderung von Flüssiggas mit Fahrzeugen auf der Straße". | |
5.1.15 Brandschutz bei Flüssiggasanlagen
Die Unternehmerin oder der Unternehmer ermittelt in der Gefährdungsbeurteilung, ob beim Einsatz der Flüssiggasanlage Brandgefahr besteht oder sich gefährliche explosionsfähige Atmosphäre (g. e. A.) bilden kann. Die Flüssiggasanlagen müssen so betrieben werden, dass eine Brand- und Explosionsgefahr verhindert ist und Verbrennungen oder Verbrühungen vermieden werden (siehe 5.1.1 Gefahrenbereiche und Zonen).
Die Unternehmerin oder der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Verbrauchseinrichtungen in Räumen und Bereichen, in denen mit gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre gerechnet werden muss, nur unter Beachtung der Brand- und Explosionsschutzmaßnahmen betrieben werden.
| Weitere Informationen | |
| Zur Unterstützung der Gefährdungsbeurteilung und für die Festlegung von Maßnahmen zum Brandschutz wird auf die TRGS 800 "Brandschutzmaßnahmen" und TRGS 510 "Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern" hingewiesen. | |
Geeignete Sicherheitsmaßnahmen sind z. B.:
- Fernhalten brennbarer Stoffe und Gegenstände von den Verbrauchseinrichtungen,
- Abschirmen oder Abdecken verbleibender Gegenstände oder Stoffe vor Beginn der Arbeiten,
- Aufstellen von Verbrauchseinrichtungen auf nichtbrennbaren Unterlagen,
- Kontrolle der brandgefährdeten Bereiche und ihrer Umgebung nach Durchführung der Arbeiten,
- Freihalten abgasführender Teile von Verbrauchseinrichtungen von Gegenständen und Stoffen, die sich an Wandungen der Abgasrohre, Abgasleitungen und Kaminen entzünden können,
- Festlegen der Flucht- und Rettungswege und der Sammelstelle,
- Abdichten von Öffnungen im gefährdeten Bereich und
- Bereithalten geeigneter Feuerlöscheinrichtungen (z. B. Pulverlöscher).
Für das Löschen von Flüssiggasbränden (Brandklasse C nach DIN EN 2) sind geeignete und zugelassene Feuerlöscher, z. B. Pulverlöscher mit ABC- oder BC-Löschpulver (nach DIN EN 3-7) entsprechend der Technischen Regel für Arbeitsstätten "Maßnahmen gegen Brände" ASR A2.2 leicht erreichbar bereit zu stellen. Siehe auch DGUV Information 205-025 "Feuerlöscher richtig einsetzen".
Auszugsweise gibt die Tabelle 6 einen Überblick über geeignete Feuerlöscheinrichtungen für das Löschen von Gasbränden (Brandklasse C).
Alle Arten von Feuerlöschern sind mindestens alle 2 Jahre zu prüfen. Als Nachweis dienen z. B. Prüfvermerke am Feuerlöscher.
Maßnahmen im Brandfall
Wenn ein extrem entzündbares Gas unkontrolliert freigesetzt wird, muss – solange es noch ohne Gefährdung möglich ist – die Gaszufuhr unterbrochen werden.
Brennt das ausströmende Gas und die Gaszufuhr kann nicht unterbrochen werden, dann ist das brennende Gas nicht zu löschen, um die Bildung explosionsfähiger Atmosphäre als Folge der Freisetzung des unverbrannten Gases zu vermeiden.
Im Brandfall sind die Flüssiggasflaschen aus dem brandgefährdeten Bereich zu entfernen, sofern dies ohne Gefährdung möglich ist. Mit dem Bersten der Flaschen muss bei Brandeinwirkung gerechnet werden. Weiterführende Informationen für Feuerwehren und Einsatzkräfte sind in der DGUV Information 205-030 "Umgang mit ortsbeweglichen Flüssiggasflaschen im Brandeinsatz" beschrieben.
Beim kontrollierten Abbrand von austretendem Flüssiggas, das nicht abgestellt werden kann, muss seitens der Feuerwehr eine schnelle und ausreichende Kühlung, z. B. von Flüssiggasflaschen, Behälterwandungen und Rohrleitungen, die im Einflussbereich des Feuers sind, durchgeführt werden. Kühlmaßnahmen sind auch beim Brand im Bereich von ortsfesten Behältern erforderlich.
Tabelle 6 Brandklassen nach DIN EN 2: Beispielhaft zu löschende Stoffe
| Brandklassen DIN EN 2 | |||||
| A | B | C | D | F | |
| zu löschende Stoffe | zu löschende Stoffe | ||||
| Arten von Feuerlöschern | Feste, glut-bildende Stoffe | Flüssige oder flüssig werdende Stoffe | Gasförmige Stoffe, auch unter Druck | Brennbare Metalle (Einsatz nur mit Pulver-brause) | Brände von Speiseöl und Speisefetten |
| Pulverlöscher mit ABC-Löschpulver | + | + | + | – | – |
| Pulverlöscher mit BC-Löschpulver | – | + | + | – | – |
| Pulverlöscher mit Metallbrandpulver | – | – | – | + | – |
| Kohlendioxidlöscher*) | – | + | – | – | – |
| Wasserlöscher auch mit Zusätzen, z. B. Netzmittel, Frostschutzmittel oder Korrosionsschutzmittel | + | – | – | – | – |
| Wasserlöscher mit Zusätzen, die in Verbindung mit Wasser auch Brände der Brandklasse B löschen | + | + | – | – | – |
| Fettbrandlöscher (Speziallöschmittel) | (+) | (+) | – | – | + |
| Schaumlöscher | + | + | – | – | – |
+ = geeignet; - = nicht geeignet; (+) Mögliche Brandklassen-Kombination mit der Brandklasse F nach geprüfter Eignung und Zulassung
*) Beim Einsatz in kleinen, engen Räumen besteht Erstickungsgefahr
Quelle: BGN
Besteht die Gefahr, dass ausströmendes Gas nicht mehr unter Kontrolle gebracht werden kann, oder die Gefahr eines Brandes im Bereich von Verbrauchs- und Versorgungsanlagen,
- muss die Feuerwehr unverzüglich alarmiert werden mit Hinweis auf die Flüssiggasanlage,
- müssen, soweit gefahrlos durchführbar, Zündquellen beseitigt werden und die gesamte elektrische Anlage von sicherer Stelle aus spannungsfrei geschaltet werden,
- muss der Gefahrbereich von Menschen geräumt werden.
Die Feuerwehr muss im Einsatzfall über das Vorhandensein von Flüssiggasflaschen im Brandbereich oder dessen Nähe informiert werden.
Bei der Alarmierung über Notruf 112 können durch die Leitstelle folgende Fragen gestellt werden:
- Wo ist etwas passiert?
- Was ist passiert?
- Wer ruft an?
- Wie viele Verletzte?
Die Leitstelle beendet das Gespräch!
Es ist wichtig, bei der Meldung eines Brandes auf mögliche Gefahrenstellen hinzuweisen, wie z. B.:
|
Grundsätzlich gilt:
- Menschenrettung geht vor Brandbekämpfung,
- Erst melden, dann löschen.
Flüssiggasflaschen, die gebrannt haben, örtlich erhitzt oder der Brandhitze ausgesetzt waren, müssen deutlich entsprechend gekennzeichnet werden, damit sie nicht wiederverwendet werden. Sie müssen an den Lieferanten bzw. an das Füllwerk zurückgegeben werden.
5.1.16 Instandhaltung
Die Unternehmerin oder der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die erforderlichen Instandhaltungsarbeiten durchgeführt werden, um die Flüssiggasanlage in einem sicheren Zustand zu erhalten. Hinsichtlich der Nutzungsdauer von Ausrüstungsteilen, z. B. Druckregeleinrichtungen sowie Rohrleitungen, sind die Angaben der Hersteller zu beachten. Entsprechend der Gefährdungsbeurteilung – aber spätestens nach 10 Jahren – sind die Druckregeleinrichtungen, Leckgassicherungen und Schlauchleitungen der Flüssiggasanlage auszutauschen. Notwendige Instandhaltungsarbeiten sind unverzüglich durchzuführen und die dabei erforderlichen Schutzmaßnahmen zu treffen. Für die Instandhaltung sind insbesondere die Regelungen des § 10 der BetrSichV zu beachten.
Für die Instandhaltung dürfen nur geeignete Ersatzteile und Hilfsmittel zur Verfügung gestellt und verwendet werden.
Die Forderung nach geeigneten Ersatzteilen ist erfüllt durch Verwendung von
- Original-Ersatzteilen des Herstellers,
- Ersatzteilen, die nach den kompletten Fertigungsunterlagen des Herstellers der Originalteile gefertigt worden sind, oder
- anderen Ersatzteilen und anschließender Prüfung durch die zur Prüfung befähigte Person für Flüssiggasanlagen nach der entsprechenden Geräte-Norm sowie Aufzeichnung des Prüfergebnisses.
Geeignete Hilfsmittel sind z. B.
- Pumpen,
- Verdichter,
- Messeinrichtungen,
- Ableitungsschläuche,
- Inertgase,
- schaumbildende Mittel,
- Blasensetzgeräte.
Bei Mängeln an Ausrüstungsteilen von Flüssiggasflaschen, z. B. Flaschenventile, die sich nicht mehr von Hand bedienen lassen, ist die Instandhaltung der Flüssiggasflaschen durch den Flüssiggasversorger durchzuführen.
|
In der Gefährdungsbeurteilung ist zu ermitteln, ob eine Instandhaltungsmaßnahme an der Flüssiggasanlage prüfpflichtig ist. Bei Flüssiggasanlagen gemäß Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV sind nach Austausch von Ausrüstungsteilen der Verbrauchsanlage, soweit deren sichere Verwendung von den Montagebedingungen abhängt, oder die schädigenden Einflüssen unterliegen, grundsätzlich Prüfungen gemäß § 14 BetrSichV durchzuführen (siehe TRBS 1201 "Prüfungen und Kontrollen von Arbeitsmitteln und überwachungsbedürftigen Anlagen").
Hiervon betroffen ist z. B. der Austausch von
Notwendige Prüfungen im Rahmen von Instandhaltungsarbeiten an Flüssiggasanlagen gemäß Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV sind von einer zur Prüfung befähigten Person für Flüssiggasanlagen durchzuführen (siehe 6 Prüfungen und Prüffristen von Flüssiggasanlagen zu Brennzwecken). Werden im Rahmen von Instandsetzungsmaßnahmen an Verbrauchsanlagen gemäß TRBS 1112 Schlauchleitungen durch identische oder baugleiche (mit identischen Sicherheits- und Betriebsparametern) ausgetauscht, ist dies keine prüfpflichtige Änderung, wenn:
Unabhängig hiervon sind Kontrollen vor Wiederverwendung durch von den Unternehmerinnen und Unternehmern besonders unterwiesene, fachkundige Beschäftigte durchzuführen. |
5.1.17 Verhalten bei Störungen
Die Gaszufuhr zu den Verbrauchseinrichtungen und zur Verbrauchsanlage muss bei Störungen, z. B. unvollständiger Verbrennung oder ungewolltem Austritt von unverbranntem Flüssiggas, sofort unterbrochen werden.
In diesem Fall ist die zugehörige Absperreinrichtung unverzüglich zu schließen, wenn dies ohne Gefährdung möglich ist. Falls aus verfahrenstechnischen Gründen andere Absperrmaßnahmen getroffen werden müssen, ist dies in der Gefährdungsbeurteilung zu berücksichtigen und in die Betriebsanweisung aufzunehmen.
Eine Wiederinbetriebnahme der Flüssiggasanlage darf erst erfolgen, nachdem die Störungsursache beseitigt und eine Prüfung vor Wiederinbetriebnahme durch eine zur Prüfung befähigte Person für Flüssiggasanlagen durchgeführt wurde.
Die Unternehmerin oder der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass
- die Gaszufuhr zu den Verbrauchseinrichtungen sofort unterbrochen werden kann, um einen unkontrollierten Gasaustritt an den Verbrauchseinrichtungen zu verhindern (z. B. mittels Geräteabsperrarmatur),
- die Gaszufuhr zu der gesamten Verbrauchsanlage sofort unterbrochen werden kann (z. B. mittels Flüssiggasflaschenventil),
- eine Betriebsanweisung in der für die Beschäftigten verständlichen Form und Sprache zur Verfügung steht, in der alle für die sichere Benutzung erforderlichen Angaben, z. B. das Verhalten bei Störungen, enthalten sein müssen. Siehe BGN Branchenwissen, Wissen Kompakt Flüssiggas www.bgn.de/754,
- die Beschäftigten vor Verwendung der Flüssiggasanlage und wiederkehrend in regelmäßigen Abständen über das richtige Verhalten bei Störungen unterwiesen werden.
5.1.18 Anzeigen von Unfällen und Schadensfällen
Die Unternehmerin oder der Unternehmer muss gemäß § 19 BetrSichV der zuständigen Behörde folgende Ereignisse an Flüssiggasanlagen unverzüglich anzeigen:
- jeden Unfall, bei dem ein Mensch getötet oder erheblich verletzt worden ist, und
- jeden Schadensfall, bei dem Bauteile oder sicherheitstechnische Einrichtungen versagt haben.
5.1.19 Lagerung von Flüssiggasflaschen
Unter Lagern von Flüssiggasflaschen wird das Aufbewahren zur späteren Verwendung sowie zur Abgabe an andere verstanden. Es schließt die Bereitstellung zur Beförderung ein, wenn die Beförderung nicht innerhalb von 24 Stunden nach der Bereitstellung oder am darauffolgenden Werktag erfolgt. Ist dieser Werktag ein Samstag, so endet die Frist mit Ablauf des nächsten Werktags.
Bei Nachweis der Dichtheit der Flüssiggasflaschenventile durch Kontrolle, z. B. mit schaumbildenden Mitteln, ist bei der Lagerung von Flüssiggas keine Zone vorhanden.
Dies gilt auch für teilentleerte Flaschen, wenn diese Kontrolle vor Rückführung in das Lager durchgeführt wurde.
Die Unternehmerin oder der Unternehmer muss immer die möglichen Gefahrenbereiche bewerten.
Auch bei der Lagerung von Flüssiggas müssen Gefährdungen vermieden werden. Erfahrungsgemäß ist deshalb die Lagerung von Flüssiggasflaschen im Freien der Lagerung in Räumen vorzuziehen.
Bei der Festlegung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Lagerung sind neben der Bevorratung an sich auch folgende Tätigkeiten zu berücksichtigen:
- das Ein- und Auslagern,
- der Transport innerhalb des Lagers und
- die Bereitstellung zur Beförderung, wenn diese nicht innerhalb von 24 Stunden oder am darauffolgenden Werktag des Bereitstellens erfolgt.
Generell gilt, dass bei mehr als einer Flasche oder mehr als 50 kg Flüssiggas die Flüssiggasflaschen in einem Lager aufbewahrt werden müssen. Zur Lagerung von Einwegbehältern (Druckgaskartuschen) siehe 5.2.2 Flüssiggasanlagen mit Einwegbehältern (Druckgaskartuschen).
Es werden die folgenden Arten der Lagerung unterschieden:
- Lagerung im Freien,
- Lagerung in Räumen und
- Lagerung in Räumen unter Erdgleiche.
Wegen der extremen Entzündbarkeit und Explosionsgefahr von Flüssiggas werden an die verschiedenen Arten der Lagerung bestimmte Anforderungen gestellt.
Darüber hinaus sind, abhängig von der gelagerten Menge an Flüssiggas, weitere Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Dabei werden drei Mengen-Bereiche unterschieden:
Tabelle 7 Geforderte Schutzmaßnahmen in Abhängigkeit von der Lagermenge
| Geforderte Schutzmaßnahmen in Abhängigkeit von der Lagermenge | |||
| Flüssiggas in Flüssiggasflaschen | |||
| eine Flüssiggasflasche oder max. 50 kg* | mehr als eine Flüssiggasflasche oder mehr als 50 kg, bis zu 200 kg |
> 200 kg | |
| Allgemeine Schutzmaßnahmen | X | X | X |
| Weitere Schutzmaßnahmen | X | X | |
| Spezifische Schutzmaßnahmen für Großmengen | X | ||
*) Beim Überschreiten einer der beiden Mengen ist die nächste Spalte anzuwenden.
Allgemeine Schutzmaßnahmen
Unabhängig von der Lagermenge müssen die folgenden Anforderungen bezüglich der Lagerung von Flüssiggasflaschen erfüllt sein:
- Flüssiggasflaschen stehend lagern,
- Flüssiggasflaschen gegen Umfallen oder Herabfallen sichern,
- Flaschenventile der Flüssiggasflaschen durch Ventilschutzkappen sichern,
- keine Lagerung in Verkehrswegen (z. B. Treppenräume, Flucht- und Rettungswege, Durchgänge, enge Höfe),
- Einhaltung der Mindestabstände zu möglichen Zündquellen, wie beispielsweise heiße Oberflächen oder Heizungen (siehe 5.1.3 Aufstellung von Flüssiggasanlagen),
- generelles Rauchverbot, kein Umgang mit offenem Feuer sowie keine Funken erzeugenden Arbeiten,
- schnelle Identifizierung von Gefahrstoffen sicherstellen: Kennzeichnung, Informationen über Einstufung und Handhabung, Gewährleistung notwendiger Schutzmaßnahmen,
- Auswahl von fachkundigen Beschäftigten inkl. Schulung, Unterweisung, Koordination der Arbeitsabläufe,
- ebene und feste Aufstellflächen, auf denen Flaschen sicher stehen und
- Erstellen von Handlungsanweisungen für das Verhalten von betriebsfremden Personen.
Kennzeichnung der Flüssiggasflaschen:
Gefahrstoffe wie Flüssiggas müssen eindeutig identifizierbar sein. Das erforderliche Etikett muss neben dem Stoffnamen und der Inhaltsmenge auch Piktogramme/Gefahrzettel, Signalwort, Gefahrenhinweise für Entzündbarkeit tragen.
Tabelle 8 Verbindliches Element zur Gefahrgutkennzeichnung
| Piktogramm/Gefahrzettel | Signalwort | Gefahrenhinweis | |
 |
Gefahr | H220 | Extrem entzündbares Gas |
Weitere Schutzmaßnahmen bei Lagerung von mehr als einer Flüssiggasflasche oder Mengen > 50 kg
Bei den oben genannten Mengen müssen Flüssiggasflaschen ohne Ausnahme in einem Lager bzw. Sicherheitsschrank (gemäß DIN EN 14470-2) aufbewahrt werden. Im Falle eines Lagers müssen folgende Schutzmaßnahmen ergriffen werden.
Kennzeichnung des Lagers:
Das Lager für Flüssiggas muss mit Piktogrammen der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung wie folgt gekennzeichnet werden:
Tabelle 9 Kennzeichnung des Lagers
| Piktogramm | ID | Wortlaut |
 |
D-P006 | Zutritt für Unbefugte verboten (aus DIN 4844-2 "Graphische Symbole – Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen – Teil 2" Ausgabe November 2021) |
 |
P003 | Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten |
 |
D-W021 | Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre |
 |
W029 | Warnung vor Gasflaschen |
Generell gilt, dass die Kennzeichnung deutlich erkennbar und dauerhaft angebracht sein muss.
Bauliche Schutzmaßnahmen:
- Lagereinrichtung ausreichend statisch belastbar und standsicher erstellen inkl. Anfahrschutz und Aushebesicherungen
- ausreichende Beleuchtung ohne Erwärmung des Lagerguts (in der Regel mindestens 50 Lux)
- ausreichende Belüftung (technische oder natürliche Belüftung siehe 5.1.19.2 Lagerung in Räumen)
- Abgrenzung von unmittelbar angrenzenden öffentlichen Verkehrswegen durch mindestens 2 m hohe Wand
Sicherung des Lagergutes:
- Flüssiggasflaschen gegen Umfallen oder Herabfallen durch Ketten, Bügel oder spezielle Transportboxen sichern
- Schutz der Flaschenventile durch Ventilschutzkappen
- Sicherung gegen Zugriff Unbefugter
Organisatorische Sicherheitsmaßnahmen:
- übersichtliche Lagerung
- Lagereinrichtungen regelmäßig überprüfen (entsprechend der Gefährdungsbeurteilung)
- Bereithaltung stoffspezifischer Informationen wie Sicherheitsdatenblätter
- Erstellen von Betriebsanweisungen
- Übertragung der Lager-Tätigkeiten an unterwiesene Beschäftigte
- Erstellen eines Gefahrstoffverzeichnisses
- keine Umfüllarbeiten sowie keine Instandhaltungsarbeiten an Druckgasbehältern
Zusammenlagerung:
Bei Lagerung von mehr als einer Flüssiggasflasche oder Mengen größer 50 kg sind die Zusammenlagerungsregeln des Kapitels der TRGS 510 "Zusammenlagerung, Getrenntlagerung und Separatlagerung" zu beachten, wenn die Gesamtmenge aller Gefahrstoffe 200 kg überschreitet.
Grundsätzlich gilt:
Flüssiggas ist der Lagerklasse 2 A zugeordnet. Flüssiggasflaschen dürfen ohne weitere Sicherheitsmaßnahmen mit nichtbrennbaren Stoffen zusammen gelagert werden, jedoch nicht mit brennbaren Stoffen, wie beispielsweise Papier, Holz oder brennbaren Flüssigkeiten sowie mit giftigen Stoffen.
Spezifische Schutzmaßnahmen bei Mengen > 200 kg
Brandschutzmaßnahmen:
Bei Mengen > 200 kg muss das Lager zusätzlich mit dem Warnzeichen W021 gekennzeichnet und zusätzliche Brandschutzmaßnahmen ergriffen werden. Siehe hierzu TRGS 510 "Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern".
Tabelle 10 Zusätzliche Kennzeichnung eines Lagers mit einer Lagermenge > 200 kg
| Piktogramm | ID | Wortlaut |
 |
W021 | Warnung vor feuergefährlichen Stoffen |
Lagerung entleerter Flüssiggasflaschen:
Erfahrungsgemäß sind entleerte Gebinde niemals ganz leer – dies gilt auch für Flüssiggasflaschen. Auch entleerte Flüssiggasflaschen können umfallen, wenn sie nicht gesichert stehen. Weiterhin ist darauf zu achten, dass bei der Lagerung und dem Transport die Flaschenventile fest verschlossen sind, Ventilverschlussmuttern von Kleinflaschen aufgeschraubt und Schutzkappen von Flüssiggasflaschen angebracht sind. Darüber hinaus sind entleerte Flüssiggasflaschen vor gefährlicher Erwärmung von über 40 °C, z. B. durch Heizkörper oder Heizgeräte mit offener Flamme, zu schützen.
5.1.19.1 Lagerung im Freien
Unter einem Lager im Freien versteht man
- überdachte Flächen, die mindestens nach zwei Seiten offen sind. Dabei gelten auch Seitenwände aus Gitter, Draht oder ähnlichen luftdurchlässigen Materialien als offen.
- Bauten, die nur an einer Seite offen sind, wobei die Tiefe von der offenen Seite aus gemessen nicht größer als die Höhe der offenen Seite ist.
Beim Lagern im Freien gelten im Gegensatz zum Lagern in Räumen weitaus weniger strenge Anforderungen, da hier insbesondere die Belüftung durch die Bauart leichter zu realisieren ist. Jedoch werden auch an diese Art von Lagerung weitere Anforderungen gestellt, die im Folgenden aufgeführt werden.

Abb. 32 Lagerung von Flüssiggasflaschen im Freien
Schutzmaßnahmen
- Die Lagerung in engen Höfen, in Durchgängen und Durchfahrten ist generell verboten.
- Im Gefahrenbereich dürfen sich keine Gruben, Kanäle, Luftansaugschächte, Abflüsse und tiefer gelegene Räume befinden.
- Eine Feuerlöscheinrichtung ist in der Nähe anzubringen und gegen Witterungseinflüsse zu schützen.
- Der Zugang ist gegen Unbefugte zu sichern.
- Zu brandgefährdeten Anlagen und Einrichtungen, z. B. Lager mit brennbaren Stoffen, ist ein Sicherheitsabstand von mindestens 5,0 m einzurichten. Alternativ kann eine 2,0 m hohe Schutzwand aus nichtbrennbaren Baustoffen den Sicherheitsabstand ersetzen.
- Die Aufstellflächen müssen eben und fest sein, so dass die Flaschen sicher stehen können.
- Ein Schutz gegen direkte Sonneneinstrahlung ist zwar rechtlich nicht zwingend vorgeschrieben, jedoch zu empfehlen.
Zu beachten: Insbesondere beim Lagern im Freien kann es bei direkter Sonneneinstrahlung durch Temperaturanstieg zu einem starken Druckanstieg in der Flüssiggasflasche kommen (siehe Anhang 1, Diagramm 1 "Dampfdruckdiagramm").
Maße der Gefahrenbereiche beim Lagern im Freien
- Der Gefahrenbereich darf an höchstens zwei Seiten durch mind. 2,0 m hohe Schutzwände eingeengt werden.
- Der Gefahrenbereich darf sich nicht auf Nachbargrundstücke und öffentliche Verkehrsflächen erstrecken.

Abb. 33 Festgelegte Maße für den Gefahrenbereich bei der Lagerung im Freien
5.1.19.2 Lagerung in Räumen
Unter Lagern in Räumen versteht man die Unterbringung von Flüssiggasflaschen in geschlossenen Räumen bzw. in Räumen mit maximal einer offenen Seite.
Beim Lagern in Räumen werden drei verschiedene Bereiche unterschieden und dementsprechend andere Anforderungen gestellt:
- Lagerung in Lagerräumen (getrennt von Arbeitsräumen)
- Lagerung in Arbeitsräumen
- Lagerung in Räumen unter Erdgleiche (Räume, die allseitig tiefer als 1 m unter der umgebenden Geländeoberfläche liegen: Keller, Gruben)

Abb. 34 Lagern von Flüssiggasflaschen im Lagerraum
Schutzmaßnahmen
Generell gelten – unabhängig davon, in welcher Räumlichkeit Flüssiggasflaschen gelagert werden – die folgenden Sicherheitsanforderungen:
- Lagerräume dürfen weder Gruben, Kanäle oder Abflüsse besitzen (außer diese sind ständig mit Wasser gefüllt oder anderweitig geschlossen). Darüber hinaus dürfen sich in Lagerräumen keine Kellerzugänge oder sonstige offene Verbindungen in tiefergelegene Räume befinden.
- Die Lagerung in Treppenräumen, Fluren, Durchgängen sowie im Bereich von Flucht- und Rettungswegen ist generell verboten.
- Eine ausreichende Belüftung in Bodenhöhe muss sichergestellt sein. Eine natürliche Lüftung ist ausreichend, wenn bei einer Querlüftung jede Öffnungsfläche mindestens 1 % der Lager-Bodenfläche, mindestens aber jeweils 100 cm² groß ist.
- Abtrennungen müssen durch feuerhemmende Bauteile (min. F30) ausgeführt sein.
- Bodenbeläge müssen schwer entflammbar und bei mehr als 5 Flaschen nicht brennbar sein.
Gefahrenbereiche beim Lagern in Räumen
Beträgt die Fläche des Lagerraums < 20 m², ist der gesamte Raum als Gefahrenbereich anzusehen.
Beträgt die Fläche des Lagerraums ≥ 20 m², gilt als Gefahrenbereich:
- in der Fläche: die Lagerfläche plus 2 m Sicherheitsradius und
- in der Höhe: plus 1 m Höhe Sicherheitsradius oberhalb des Flaschenventils
Siehe Abbildung 35.
Tabelle 11 Gefahrenbereiche beim Lagern in Räumen nach TRGS 510
| Gefahrenbereiche beim Lagern von Flüssiggasflaschen in Räumen | |
| Fläche Lagerraum < 20 m² Hier ist der gesamte Raum Gefahrenbereich |
Fläche Lagerraum ≥ 20 m² Radius r2/1 = 2,0 m um die Flüssiggasflaschen Höhe r2/2 = 1,0 m um Flaschenventil |
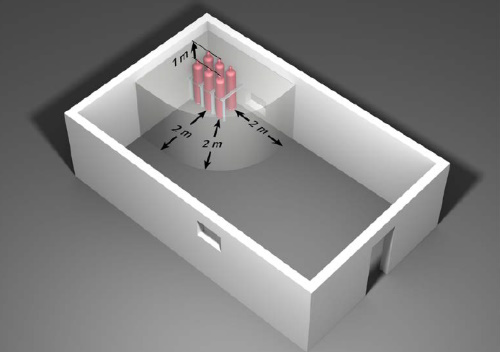
Abb. 35 Geometrische Abmessungen für den Gefahrenbereich im Lagerraum ≥ 20 m²
Spezielle Anforderungen an Lager in Arbeitsräumen
Zu den Arbeitsräumen zählen beispielsweise Küchen, Verkaufsräume und Werkstätten. Hier müssen Flüssiggasflaschen, die nicht unter Einhaltung der in 5.1.3.1 Aufstellung von Flüssiggasflaschenanlagen genannten Menge (Priorität 3) zum Verbrauch bereitgehalten sind, in einem Sicherheitsschrank entsprechend der Empfehlung nach TRGS 510 "Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern" gelagert werden (Sicherheitsschrank entsprechend DIN EN 14470-2).
Lagerung in Räumen unter Erdgleiche
Grundsätzlich gilt ein Verbot der Lagerung von Flüssiggas in Räumen unter Erdgleiche, wie beispielsweise in Kellerräumen.
Die möglichen Ausnahmen bedingen einen erheblichen sicherheitstechnischen Aufwand und besondere räumliche Anforderungen (siehe TRGS 510). Deshalb wird von einer Lagerung unter Erdgleiche abgeraten.
5.2 Zusätzliche Regeln für besondere Flüssiggasanlagen
Für alle unter diesem Abschnitt behandelten besonderen Flüssiggasanlagen gelten grundsätzlich auch alle Regeln, die unter Abschnitt 5.1 Gemeinsame Regeln für alle Flüssiggasanlagen beschrieben sind.
5.2.1 Flüssiggasanlagen für Bauarbeiten zum Schmelzen, Vorwärmen und Auftragen von Baustoffen
5.2.1.1 Besondere Flüssiggasanlagen für Bauarbeiten unter Erdgleiche und in engen Räumen
Der Einsatz von Flüssiggasanlagen im Bauwesen ist von einer hohen Mobilität der Anlagen und von besonderen örtlichen und zeitlichen Gegebenheiten geprägt. Die Unternehmerin oder der Unternehmer hat bei Bauarbeiten die Möglichkeit, abweichend von 5.1.3.1 Aufstellung von Flüssiggasflaschenanlagen (6) Flüssiggasflaschenanlagen auch in Bereichen unter Erdgleiche und in engen Räumen einzusetzen, wenn dies aus betriebstechnischen Gründen notwendig ist.
Wenn der Einsatz unter Erdgleiche oder in engen Räumen geplant ist, müssen folgende zusätzliche Voraussetzungen gegeben sein:
- eine spezielle Betriebsanweisung für die durchzuführenden Arbeiten,
- geeignete Ausrüstungsteile, wie zum Beispiel eine Druckregeleinrichtung mit Leckgassicherung und doppelwandiger Schlauchleitung,
- keine Lagerung von Flüssiggas unter Erdgleiche,
- kein Flaschenwechsel unter Erdgleiche,
- ständige Beaufsichtigung der Flüssiggasanlage.
Bei der Dimensionierung der Anlage ist darauf zu achten, dass sich im Arbeitsbereich nur die angeschlossene Flasche befindet. Es darf abweichend von den Regelungen der TRBS 3145/TRGS 745 kein Bereithalten und auch kein Flaschenwechsel im Arbeitsbereich stattfinden.
| Trotz der möglichen Abweichungen ist das Arbeiten mit Flüssiggas in Bohrungen und bei Arbeiten unter Druckluft nicht zulässig! |
5.2.1.2 Geräte zum Heizen und Trocknen
| Heizgeräte zum Austrocknen dürfen nur in Räumen mit einer für die Verbrennung ausreichenden Luftzufuhr betrieben werden (siehe 5.1.12 Lüftungseinrichtungen/Abgasleitungen). In diesen Räumen ist der ständige Aufenthalt von Personen verboten. |
Auf das Verbot ist an den Eingängen der Räume durch das allgemeine Verbotszeichen mit einem Zusatzzeichen mit der Aufschrift "Der ständige Aufenthalt von Personen ist in diesen Räumen verboten" hinzuweisen (nach ASR A1.3 "Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung" D-P006).
Tabelle 12 Allgemeines Verbotszeichen an Räumen mit Heizgeräten
| Piktogramm | ID | Wortlaut |
 |
D-P006 | Zutritt für Unbefugte verboten |
Wenn geplant ist, in Räumen über Erdgleiche Verbrauchseinrichtungen zum Austrocknen und Heizen im durchgehenden Betrieb einzusetzen, muss folgendes beachtet werden:
- die Flüssiggasflaschen über Erdgleiche aufstellen,
- Druckregeleinrichtung mit Leckgassicherung und doppelwandigen Schlauchleitungen verwenden und
- die Flüssiggasanlage von einer von der Unternehmerin oder dem Unternehmer beauftragten fachkundigen Person mindestens einmal täglich kontrollieren lassen.
Inhalt der Kontrolle ist insbesondere- die sichere Aufstellung der Flüssiggasflaschen und ortsfesten Druckgasbehälter,
- Verlegung, Anschluss und Dichtheit der Rohrleitungen sowie
- die Aufstellung des Bautrockners oder der Heizung nach Herstellerangabe.
| Wenn Heizgeräte unter Erdgleiche eingesetzt werden sollen, dürfen nur Heizgeräte mit Gebläse eingesetzt werden! Heizgeräte mit Gebläse sind auch erforderlich, wenn die Verbrauchseinrichtungen und zugehörige Druckgasbehälter im Freien oder in Räumen über Erdgleiche betrieben werden, bei denen die erwärmte Luft über flexible Schläuche in Räume geleitet wird. |
Bei der Verwendung von Handbrennern hat die Unternehmerin oder der Unternehmer dafür zu sorgen, dass
- nur Handbrenner verwendet werden, die der Bauart nach nur aus der Gasphase betrieben werden dürfen,
- bei Handbrennern mit mehr als 100 mm Flammenlänge die Flammenlänge beim Loslassen des Stellteiles automatisch auf 100 mm Flammenlänge begrenzt wird (Flammenkleinstelleinrichtung) oder die Gaszufuhr abgesperrt wird.
5.2.1.3 Ortsveränderliche Schmelzöfen mit Flüssiggas-Feuerung
Schmelzöfen, die fest mit Straßenfahrzeugen verbunden oder Bestandteil von Straßenfahrzeugen sind, werden den ortsveränderlichen Schmelzöfen gleichgestellt. Je nach Art des eingebauten Brenners werden unterschiedliche Anforderungen an die Ausrüstung sowie an die notwendigen sicherheitstechnischen Einrichtungen des Ofens gestellt. Diese Anforderungen sind der Betriebsanleitung des Herstellers zu entnehmen.
Schmelzgeräte und Warmhaltegeräte dürfen gemäß DIN 30695-1: "Ortsveränderliche Schmelzöfen mit Flüssiggas-Feuerung" für bituminöse oder andere heiß zu verarbeitende Baustoffe nicht ohne Flammenüberwachungseinrichtung betrieben werden. Zusätzlich müssen alle Öfen mit mehr als 30 Liter Füllmenge ein geeignetes fest eingebautes Thermometer haben. Öfen mit mehr als 50 Liter Füllmenge müssen eine Einrichtung haben, die ein Überschreiten der höchstzulässigen Schmelzguttemperatur selbsttätig verhindert.
5.2.1.4 Vorwärmgeräte für Straßenbeläge
Wenn flüssiggasbetriebene Vorwärmgeräte für Straßenbeläge verwendet werden sollen, müssen alle Maßnahmen zum sicheren Betrieb der Vorwärmgeräte in einer Betriebsanweisung (siehe 5.1.2 Explosionsschutzdokument) erfasst und die Beschäftigten unterwiesen werden. Grundlage dieser Betriebsanweisung ist neben den staatlichen Vorschriften und den Vorschriften der Unfallversicherungsträger auch die Bedienungsanleitung des Herstellers.
Folgende Inhalte müssen in der Betriebsanweisung als Anweisungen an den Maschinenführer oder die -führerin mindestens enthalten sein:
- Der Maschinenführer oder die -führerin muss vor Beginn jeder Arbeitsschicht die Flüssiggasanlage auf offensichtliche Mängel und sichere Funktion kontrollieren.
- Der Maschinenführer oder die -führerin kontrolliert nach dem Auswechseln von Flüssiggasflaschen alle Anschlüsse auf Dichtheit und sorgt dafür, dass eventuell auftretende Mängel sofort beseitigt werden. Ist dies nicht möglich, muss der Maschinenführer oder die -führerin die Anlage außer Betrieb setzen.
- Wenn die Flüssiggasflaschen gewechselt werden, ist das Vorwärmgerät durch den Maschinenführer oder die -führerin gegen unbeabsichtigtes Bewegen zu sichern sowie der Motor und die Heizeinrichtung abzustellen.
- Der Maschinenführer oder die -führerin muss den Druck in der Verbrauchsanlage ständig überwachen können.
5.2.1.5 Mobile Verbrauchsanlagen mit Entnahme von Flüssiggas aus der Flüssigphase
Die Unternehmerin oder der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass mobile Verbrauchsanlagen mit Entnahme des Flüssiggases aus der Flüssigphase nur dann in Betrieb genommen werden, wenn sie den zu erwartenden Beanspruchungen sicher genügen. Beschäftigte dürfen bei deren Betrieb zu keiner Zeit gefährdet werden.
Grundsätzlich sind vor jeder Inbetriebnahme der Verbrauchseinrichtung alle Anschlüsse auf Dichtheit zu kontrollieren.
Verbrauchsanlagen mit Entnahme von Flüssiggas aus der Flüssigphase müssen nach jedem Absperren der Gaszufuhr restlos entleert werden. Die Nachbrennzeit muss so bemessen sein, dass die ausdampfende Restgasmenge auf ein nicht zündfähiges Gemisch reduziert wird.
Die Unternehmerin oder der Unternehmer muss sicherstellen, dass ausschließlich Verbrauchsanlagen zum Einsatz kommen, bei denen die Gaszufuhr zu den Verdampfungsbrennern jederzeit unterbrochen werden kann.
| Anlagen mit Verdampfungsbrennern dürfen nicht unter Erdgleiche betrieben werden. |
Die Zündung der Anlage darf nur in Bereichen vorgenommen werden, in denen keine Gefahr des Eindringens von Flüssiggas in den Untergrund oder in tiefergelegene Räume besteht.
Die Unternehmerin oder der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass abweichend von der TRBS 3145/TRGS 745 "Ortsbewegliche Druckgasbehälter – Füllen, Bereithalten, innerbetriebliche Beförderung, Entleeren" die Verbrauchsanlagen mit Entnahme von Flüssiggas aus der Flüssigphase
- entsprechend den Einsatzbedingungen und betrieblichen Verhältnissen,
- nach Bedarf und außergewöhnlichen Betriebsereignissen,
- mindestens jedoch einmal jährlich,
durch eine zur Prüfung befähigte Person für Flüssiggasanlagen gemäß TRBS 1203 "Zur Prüfung befähigte Personen" auf ihren betriebstechnischen Zustand geprüft werden (siehe 6 Prüfungen und Prüffristen von Flüssiggasanlagen zu Brennzwecken). Die Prüfergebnisse sind schriftlich zu dokumentieren und an der Verwendungsstelle vorzuhalten.
An Verbrauchsanlagen mit Entnahme von Flüssiggas aus der Flüssigphase sind vorhandene Feuerlöscher jährlich zu prüfen.
5.2.2 Flüssiggasanlagen mit Einwegbehältern (Druckgaskartuschen)
| Die Verwendung einer Flüssiggasanlage mit Versorgung aus einer "Anstechkartusche" ist im gewerblichen Bereich verboten. |
Begründung:
Beim Aufschrauben der in der Halterung befindlichen Anstechkartusche wird diese durch einen in der Verbrauchseinrichtung befindlichen Dorn geöffnet und kann danach nicht wieder dicht verschlossen werden. Dadurch besitzt die Anstechkartusche kein Hauptabsperrventil, das z. B. zum Arbeitsschluss geschlossen werden muss (siehe 5.1.13 Außerbetriebnahme von Verbrauchsanlagen). Bei einer entstehenden Undichtheit können z. B. aus einer Anstechkartusche mit 190 g Flüssiggas ca. 6 m³ explosionsfähiges Gas-Luft-Gemisch entstehen.
Im gewerblichen Bereich erlaubt ist die Verwendung von Einwegbehältern, wie Ventilkartusche und metallische Einwegflasche.
Eine Flüssiggasanlage mit Einwegbehälter darf nur betrieben werden, wenn
- keine unzulässige Erwärmung des Einwegbehälters auftreten kann,
- ein unbeabsichtigtes Lösen des Einwegbehälters verhindert ist und
- der Einwegbehälter so eingesetzt wird, dass die aufgebrachten Sicherheitshinweise auch im eingesetzten Zustand lesbar bleiben oder Sicherheitshinweise an der Verbrauchsanlage jederzeit lesbar angebracht sind.
| Eine Flüssiggasanlage mit Einwegbehälter muss nach jeder Benutzung auf das geschlossene Nadelventil des Brenners der Verbrauchseinrichtung sowie auf äußerlich erkennbare Mängel kontrolliert werden. |
Die Einwegbehälter und Flüssiggasanlagen mit eingesetzten Einwegbehältern dürfen nicht an folgenden Orten gelagert werden:
- Orte, an denen Gefahr für diese Flüssiggasanlagen besteht (z. B. Schubladen und Werkzeugkästen),
- in Räumen unter Erdgleiche,
- in unbelüfteten Behältnissen (z. B. unbelüftete Schränke).
Bei der Lagerung von Flüssiggas in Einwegbehältern (Druckgaskartuschen) müssen diese ab einer Menge von mehr als 20 Kilogramm oder mehr als 50 Stück (nach Wahl der Unternehmerin oder des Unternehmers) in einem Lager aufbewahrt werden.
Das Auswechseln des Einwegbehälters ist im Freien oder in besonders geschützten Bereichen (z. B. unter Laborabzügen) und in Bereichen ohne Zündquellen durchzuführen.
Der Einwegbehälter ist vor der Entsorgung zu entleeren.
Verwendung von tragbaren Tischkochern (mit Einwegbehältern)
Vor der Verwendung von "tragbaren Tischkochern" besteht die Pflicht zu ermitteln, ob die Verbrauchseinrichtung vom Hersteller für die gewerbliche Verwendung vorgesehen ist.
| Oft sind solche Produkte nur für die private Verwendung im Freien (z. B. Camping) vorgesehen. Herstellerangaben wie z. B. "eignet sich hervorragend für Picknicks, Tagesausflüge und alle Gelegenheiten, bei denen man unterwegs nicht auf eine frisch zubereitete Mahlzeit verzichten möchte", deuten darauf hin. |
Die Verbrauchseinrichtung muss den wesentlichen Anforderungen des Anhang I der Verordnung (EU) 2016/426 über Geräte zur Verbrennung gasförmiger Brennstoffe entsprechen. Hier ist u. a. festgelegt, dass die Freisetzung von unverbranntem Gas in allen Situationen verhindert wird, die zu einer gefährlichen Ansammlung von unverbranntem Gas führen können. Daher muss die Verbrauchseinrichtung z. B. mit einer Flammenüberwachung ausgestattet sein.
| Bevor ein tragbarer Tischkocher eingesetzt werden soll, ist darauf zu achten, dass nur Kochgefäße zugehöriger Größe verwendet werden. Die Verwendung größerer Kochgefäße (größerer Durchmesser) führt zu einer unzulässigen Temperaturerhöhung, die auf den Einwegbehälter einwirkt und diesen zum Bersten bringen kann. Durch den plötzlichen Austritt des Flüssiggases ist mit schwersten Brandverletzungen zu rechnen. |
| Tischkocher dürfen nicht mit brennender Flamme transportiert werden. |
5.2.3 Verbrauchsanlagen in Laboratorien
Die Unternehmerin oder der Unternehmer haben in Laboratorien Maßnahmen gegen den unbefugten Betrieb von Verbrauchsanlagen in Räumen zu treffen.
Dies kann z. B. erreicht werden durch Absperreinrichtungen vor den Räumen. Die Absperreinrichtungen sind gegen unbeabsichtigtes Öffnen zu sichern.
| Weitere Informationen | |
| Hinsichtlich der Gasinstallationen von Verbrauchsanlagen in Laboratorien siehe DVGW-Arbeitsblatt G 621 "Gasinstallationen in Laborräumen und naturwissenschaftlichen Unterrichtsräumen – Planung, Erstellung, Änderung, Instandhaltung und Betrieb". | |
5.2.4 Flüssiggasanlagen in Einrichtungen für das Unterrichtswesen
Hinsichtlich Aufstellung, Installation und Betrieb der Flüssiggasanlagen sind grundsätzlich die Anforderungen dieser DGUV Regel zu beachten. Bei Flüssiggasanlagen für das Unterrichtswesen ist zusätzlich das DVGW-Arbeitsblatt G 621 "Gasinstallationen in Laborräumen und naturwissenschaftlichen Unterrichtsräumen – Planung, Erstellung, Änderung, Instandhaltung und Betrieb" zu beachten.
Für die Lagerung von Behältern mit Flüssiggas im Unterrichtswesen gelten die Anforderungen der TRGS 510 "Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern".
Prüfungen der Flüssiggasanlagen in Unterrichtsräumen sind entsprechend 6 Prüfungen und Prüffristen von Flüssiggasanlagen zu Brennzwecken vorzunehmen.
Aufstellung von Flüssiggasflaschen in Einrichtungen des Unterrichtswesens
Flüssiggasflaschen sind stehend aufzubewahren und für die Entnahme aus der gasförmigen Phase stehend anzuschließen. Sie müssen so aufgestellt werden, dass eine Temperatur von 40 °C nicht überschritten wird und sie gegen mechanische Beschädigungen sowie Zugriff von unbefugten Personen geschützt sind.
Die Aufstellung von Flüssiggasflaschen zur Versorgung der Verbrauchsanlage ist unter Beachtung der Maßnahmen unter 5.1.3 Aufstellung von Flüssiggasanlagen durchzuführen. Für Flüssiggasanlagen in Einrichtungen für das Unterrichtswesen gelten folgende Aufstellungsprioritäten:
- Aufstellung der Flüssiggasflasche im Freien
- Aufstellung in einem separaten Aufstellungsraum, getrennt vom Unterrichtsraum
- Aufstellung im Unterrichtsraum in einem Gasflaschenschrank entsprechend DIN EN 14470-2
Ist die Aufstellung im Freien, in einem besonderen Aufstellungsraum oder in einem Gasflaschenschrank entsprechend DIN EN 14470-2 nicht möglich, ist dies in der Gefährdungsbeurteilung zu begründen und zu dokumentieren. In Ausnahmefällen darf zur Versorgung von Verbrauchseinrichtungen pro Unterrichtsraum eine Flüssiggasflasche bis zu einem zulässigen Füllgewicht ≤ 16 kg aufgestellt sein.
Die Flüssiggasflasche ist in einem verschließbaren Schrank aufzustellen, der den Luftaustausch mit der Raumluft erlaubt, z. B. durch unversperrbare Öffnungen in Bodennähe (freier Querschnitt mindestens 100 cm²). Der Schrank, in dem die Flüssiggasflasche aufgestellt wird, muss frei von Zündquellen sein (z. B. Boiler).
Flüssiggasflaschen dürfen grundsätzlich nicht in Räumen unter Erdgleiche aufbewahrt werden.
Versorgungs- und Verbrauchseinrichtungen dürfen grundsätzlich nur an Schlauchleitungen mit einer Länge von maximal 0,4 m angeschlossen werden. Falls der Einsatz von längeren Schlauchleitungen unvermeidbar ist, sind weitere Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, z. B. die Benutzung von Schlauchbruchsicherungen (siehe auch 5.1.8 Schlauchleitungen/Sicherungen bei Schlauchbeschädigungen).
Besondere Sicherungsmaßnahmen für Flüssiggasanlagen in Einrichtungen des Unterrichtswesens
Die Unternehmerin oder der Unternehmer (Sachkostenträger und Schulleitung) hat dafür zu sorgen, dass in Lehr-, Unterrichts- und Übungsräumen und an Schülerplätzen mit Gasentnahmestellen Maßnahmen gegen den unbefugten Betrieb von Verbrauchsanlagen getroffen werden.
Unterrichtsräume müssen daher mit einer zentralen Absperreinrichtung versehen sein, durch deren Betätigung die Gasversorgung zu allen Gasentnahmestellen des entsprechenden Raumes abgesperrt wird. Diese zentrale Absperreinrichtung muss aus zwei hintereinander geschalteten Sicherheitsventilen nach DIN EN 161, mindestens der Klasse C bestehen. Das Bedienteil muss sich an einer leicht zu erreichenden und zugänglichen Stelle im Raum (z. B. am Lehrertisch) befinden. Weiterhin ist es gegen unbefugtes Öffnen zu sichern (z. B. Schlüsselschalter).
Neben der zentralen Absperreinrichtung ist – sofern an den Schülerübungstischen eine Gasversorgung vorhanden ist – zusätzlich eine weitere Zwischen-Absperreinrichtung am Lehrertisch einzubauen. Sie soll gewährleisten, dass am Schülerübungstisch ein unbefugtes Öffnen der Gasversorgung nicht erfolgen kann. Lehrer- und Schülerbereich müssen dabei getrennt voneinander schaltbar sein.
Die zentrale Absperreinrichtung oder (besser) die Zwischen-Absperreinrichtung ist mit einer Geschlossenstellungskontrolle zu versehen. Dies ist eine Sicherheitseinrichtung, welche sicherstellen soll, dass nur dann Gas eingelassen werden kann, wenn alle Geräteanschlussarmaturen geschlossen sind. Dabei dürfen Absperreinrichtung und Sicherheitseinrichtung eine kombinierte Einrichtung sein.
Die Unternehmerin oder der Unternehmer (Schulleitung) hat dafür zu sorgen, z. B. durch Unterweisung der Lehrkräfte, dass nach Betriebsende, z. B. am Schluss der jeweiligen Unterrichtsstunde, die Gaszufuhr zu der gesamten Gasanlage des Raumes unterbrochen und gegen unbefugtes Öffnen gesichert wird, z. B. durch Abschließen mit Schlüsselschalter.
Einsatz von Flüssiggasanlagen mit Einwegbehältern (Kartuschenbrenner) in Einrichtungen des Unterrichtswesens
Für den Einsatz von Kartuschenbrennern im Unterrichtswesen gelten folgende Anforderungen:
- Flüssiggasanlagen mit Versorgung aus ortsfesten Druckgasbehältern oder ortsbeweglichen Druckgasbehältern (Flüssiggasflaschen) sind Kartuschenbrennern vorzuziehen.
- Kartuschenbrenner mit einem Rauminhalt der Druckgaskartusche von nicht mehr als 1 Liter dürfen in Räumen unter Erdgleiche benutzt werden, wenn sie nach Gebrauch in Räumen über Erdgleiche aufbewahrt werden.
- Druckgaskartuschen dürfen grundsätzlich nicht in Räumen unter Erdgleiche aufbewahrt werden.
- Stechkartuschen, d. h. Einwegbehälter ohne Ventil, die z. B. mittels Dorn angestochen werden müssen, dürfen zur Versorgung des Kartuschenbrenners nicht verwendet werden.
- Schülerinnen und Schüler dürfen im Unterricht pro Raum nur mit maximal 8 Kartuschenbrennern in Einwegbehältern (Ventilkartuschen) arbeiten, bei denen ein Entnahmeventil eingesetzt ist.
- Kartuschenbrenner müssen so betrieben werden, dass keine unzulässige Erwärmung der Druckgaskartuschen auftreten kann.
- Kartuschenbrenner dürfen nur in solcher Gebrauchslage betrieben werden, dass das Flüssiggas nicht auslaufen kann.
- Kartuschenbrenner müssen nach jeder Benutzung auf geschlossene Ventile und äußerlich erkennbare Mängel kontrolliert werden.
- Bei Kartuschenbrennern dürfen nur die von Unternehmerinnen oder Unternehmern beauftragten Lehrkräfte die Kartuschen (Einwegbehälter) auswechseln.
- Verschmutzte Kartuschenbrenner dürfen nur durch von Unternehmerinnen oder Unternehmern beauftragte Personen gereinigt werden.
Müssen Kartuschenbrenner mit angeschlossener Entnahmeeinrichtung und angebrochenem Einwegbehälter (Ventilkartusche) gelagert werden, dürfen diese wegen evtl. Undichtheiten an den Anschlüssen nur mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen zur Vermeidung der Bildung explosionsfähiger Atmosphäre gelagert werden, wie z. B. bei ausreichender Lüftung des Raumes oder in einem Sicherheitsschrank mit ausreichender Lüftung.
Ventilkartuschen in schulüblichen Mengen (Mengenbegrenzungen der TRGS 510 sind zu beachten) sind in einem Sicherheitsschrank nach DIN EN 14470 zu lagern.
5.2.5 Schrumpfsäulen, Schrumpfrahmen und Handschrumpfgeräte
Flüssiggasbetriebene Schrumpfsäulen, Schrumpfrahmen und Handschrumpfgeräte werden zum Verpacken von Waren, Umpacken von großen in kleinere Gebinde und zur Sicherung von palettierten Ladeeinheiten eingesetzt. Hierzu werden Ladeeinheiten mit schrumpffähiger Kunststofffolie, welche überwiegend aus Polyethylen niederer Dichte besteht, umhüllt und mittels Schrumpfsäule, Schrumpfrahmen oder Handschrumpfgeräten erwärmt. Durch das Erwärmen schrumpft die Folie, sodass die anschließend abgekühlte Folie das Packgut konturennah umfasst.
Während des Flämmprozesses können Gefährdungen durch die Flamme der Geräte bestehen, die schwere Verbrennungen beim Bediener und bei in der Nähe befindlichen Personen zur Folge haben können. Weitere spezifische Gefährdungen bestehen durch die Lärmemission während des Betriebs sowie durch die Schlauchleitung des Handschrumpfgerätes als Stolperstelle.
Zusätzliche mechanische Gefährdungen ergeben sich aus bewegten Teilen von kraftbetriebenen Schrumpfsäulen und Schrumpfrahmen.

Abb. 36 Schrumpfen mittels Handschrumpfgerät
Schutzmaßnahmen am Einsatzort
- In der Nähe des Einsatzortes des Gerätes dürfen keine brennbaren Gegenstände sowie feuer- oder explosionsgefährliche Stoffe gelagert werden.
- Der Druckgasbehälter muss gegen gefährliche Wärmeeinwirkung geschützt sein.
- Für eine ausreichende Durchlüftung des Raumes muss gesorgt sein.
Schutzmaßnahmen am Arbeitsgerät
- Das Gerät muss zur Sicherstellung eines gleichmäßigen Drucks eine normgerechte Druckregeleinrichtung besitzen. Hierbei ist eine für das Gerät auf Nieder- oder Mitteldruck abgestimmte Druckregeleinrichtung zu verwenden (siehe 5.1.6 Druckregeleinrichtungen und Sicherheitseinrichtungen)
- In Fließrichtung vor der Schlauchleitung muss eine Schlauchbruchsicherung installiert sein.
- Schlauchleitungen dürfen nur so lang sein, wie es für die Bewegungsfreiheit der bedienenden Person notwendig ist, um ein ungehindertes Schrumpfen durchführen zu können. Eine Überschreitung der maximalen Schlauchlänge von 8 m ist nicht zulässig.
- Es muss eine Schlauchleitung verwendet werden, die gegen die Einwirkungen von Flüssiggas in gasförmiger oder flüssiger Phase beständig ist, z. B. Schlauchleitungen, die der DIN EN 16436-2 entsprechen.
- Schadhafte und undichte Schlauchleitungen müssen sofort fachgerecht ausgetauscht und anschließend die dabei gelösten Verbindungen auf Dichtheit durch eine zur Prüfung befähigte Person für Flüssiggasanlagen geprüft werden.
- Die Flüssiggasflasche und die Schlauchleitung müssen gegen Beschädigungen geschützt sein. Dies kann z. B. durch das Befestigen der Flüssiggasflasche auf einem geeigneten Transportwagen erfolgen.
- Es muss eine Betriebsanweisung für das Handschrumpfgerät vorhanden sein, die den Beschäftigten zugänglich und für diese verständlich ist.
- Bei Beendigung der Arbeit und bei längeren Arbeitspausen muss das Ventil der Flüssiggasflasche fest verschlossen werden und das Gas, welches sich noch im Schlauch befindet, muss abgeflammt werden.
- Transportwagen für flüssiggasbetriebene Handschrumpfgeräte müssen gegen Umfallen des Behälters so gesichert und gebaut sein, dass sich Gas nicht in gefährlichen Mengen ansammeln kann.
- Das Gerät muss über eine Einrichtung verfügen, die das sichere Einhängen oder Ablegen der Schrumpfpistole ermöglicht.
Zusätzliche Schutzmaßnahmen bei Schrumpfsäulen und Schrumpfrahmen
- Der Betrieb ist so zu gestalten, dass das Eingreifen in den Einwirkbereich der Flammen und bewegter Bauteile nicht möglich ist. Dies kann z. B. durch bauliche Abtrennung realisiert werden.
- Störungen im Bewegungsablauf zwischen Brenner und Packgut müssen dazu führen, dass die Gaszufuhr abgesperrt wird.
- Schlauchleitungen dürfen nicht durch Flammen oder bewegte Bauteile beschädigt werden können.
Schutzmaßnahmen für Beschäftigte
- Um Verbrennungen zu vermeiden, ist das Tragen von hitzebeständigen Arbeitshandschuhen und schwer entflammbarer Kleidung zu empfehlen.
- Um eine Schädigung durch Lärm zu vermeiden, muss ab einem Schalldruckpegel von 80 dB(A) ein Gehörschutz zur Verfügung gestellt werden, der ab einem Schalldruckpegel von 85 dB(A) verpflichtend zu benutzen ist.
- Nur Beschäftigte, die anhand der Betriebsanweisung unterwiesen wurden, dürfen das Handschrumpfgerät bedienen.
- Die Flüssiggasflasche darf nur von unterwiesenen Beschäftigten gewechselt werden.
- Diese Beschäftigten müssen nach dem Wechsel der Flüssiggasflasche mit geeigneten Mitteln kontrollieren, ob die Anschlussverbindung dicht ist, z. B. mit einem Lecksuchspray.
5.2.6 Verbrauchsanlagen mit Zerstäubungsbrennern
Zerstäubungsbrenner im Sinne dieser DGUV Regel sind Brenner, die mit Gas aus der flüssigen Phase betrieben werden. Das Gas verlässt die Brenndüse im flüssigen Zustand.
Folgende Anforderungen sind zu beachten:
- Die Unternehmerin oder der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass nur Zerstäubungsbrenner in Betrieb genommen werden, die den zu erwartenden Beanspruchungen sicher genügen und bei deren Betrieb Beschäftigte nicht gefährdet werden. Dies kann z. B. durch zwei unabhängig voneinander selbsttätig auslösende Sicherheitsabsperrventile erreicht werden, die hinter den Zerstäubungsbrennern verwendet werden, und dadurch, dass das Düsensystem so kurz wie möglich gehalten wird. Sicherheitstechnische Anforderungen an selbsttätige Brennerabsperrventile siehe DIN EN ISO 23553-1: "Sicherheits-, Regel- und Steuereinrichtungen für Ölbrenner und Öl verbrennende Geräte – Spezielle Anforderungen – Teil 1: Automatische und halbautomatische Ventile".
- Vor jeder Inbetriebnahme der Flüssiggasanlage müssen die Abgaswege entsprechend den Vorgaben der Anlagenhersteller ausreichend durchlüftet werden (siehe DIN EN 746-2: "Industrielle Thermoprozessanlagen – Teil 2: Sicherheitsanforderungen an Feuerungen und Brennstoffführungssysteme"; Deutsche Fassung EN 746-2: 2010).
- Die Gaszufuhr zu den Zerstäubungsbrennern muss außerhalb der Aufstellungsräume der Zerstäubungsbrenner unterbrochen werden können, z. B. durch eine Hauptabsperreinrichtung.
- In Aufstellungsräumen von Zerstäubungsbrennern dürfen keine Pumpen und Verdampfer aufgestellt werden.
- In Aufstellungsräumen von Zerstäubungsbrennern muss der für die Atemluft notwendige Sauerstoffgehalt durch ausreichenden Luftwechsel – unter Berücksichtigung der Verbrennungsluftversorgung – gewährleistet sein. Hierzu beraten Fachbetriebe der Lüftungstechnik.
- In Räumen, die technologisch bedingte Bodenvertiefungen haben, muss in diesen Vertiefungen ein ausreichender Luftwechsel stattfinden.
- In Räumen mit Kanaleinläufen dürfen Zerstäubungsbrenner nur aufgestellt werden, wenn die Kanaleinläufe gasdicht ausgeführt sind.
- Zerstäubungsbrenner dürfen nur in Räumen aufgestellt werden, die so ausgeführt sind, dass bei Leckagen Gas nicht in andere Räume gelangen kann. Diese Forderung beinhaltet, dass z. B.
- Rohrdurchbrüche abgedichtet werden und
- Türen selbstschließend ausgeführt sind.
5.2.7 Flurförderzeuge und andere mobile Arbeitsmittel mit Flüssiggas-Verbrennungsmotor
Treibgasanlagen sind Anlagen, in denen Flüssiggas als Kraftstoff für Verbrennungsmotoren von Fahrzeugen verwendet wird.
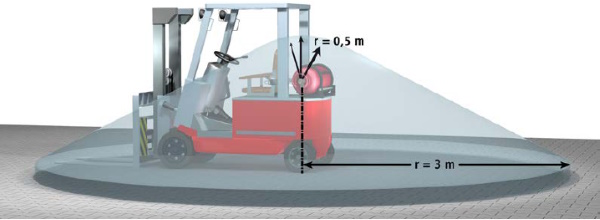
Abb. 37 Gefahrenbereich um die Treibgasflasche am abgestellten Flurförderzeug unter Beachtung der unter Abs. 17 genannten Voraussetzungen
- Treibgasanlagen von Fahrzeugen dürfen nur betrieben werden, wenn diese sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden.
- Treibgasbehälter müssen sicher am Fahrzeug befestigt werden. Verwindungen des Fahrzeugrahmens und -aufbaues dürfen auf die Treibgasbehälter und Rohrleitungen sowie deren Befestigungseinrichtungen keinen schädlichen Einfluss ausüben.
Ein sicheres Befestigen ist gewährleistet bei Verwendung von:- Spannmitteln wie Spannbügeln oder Spannbändern, z. B. Stahlbänder mit einem Mindestquerschnitt von 20 mm², keine Stahlseile,
- geeigneten Gegenlagern und
- korrosionshemmenden Zwischenlagen zwischen Treibgasbehälter und Befestigungseinrichtung.
- Treibgastanks müssen entsprechend ihrer Kennzeichnung positioniert eingebaut werden.
- Treibgasflaschen müssen am Fahrzeug so positioniert werden, dass diese waagerecht liegend betrieben und mit der Kragenöffnung (Entnahmeventil) nach unten (auf 6 Uhr) weisen.
- Abweichend von Absatz 4 können die Treibgasflaschen – gemäß der vom Hersteller angegebenen bestimmungsgemäßen Verwendung – auch mit der Kragenöffnung (Entnahmeventil) nach oben (auf 12 Uhr) positioniert werden, wenn die Entnahme aus der Gasphase erfolgen soll.
Weitere Informationen
Im Regelfall wird der Kraftstoff der Treibgasanlage aus der flüssigen Phase des Treibgasbehälters zugeführt. In seltenen Fällen, z. B. bei kleinen Fahrersitzkehrsaugmaschinen, erfolgt die Entnahme aus der Gasphase. - Rohrleitungen dürfen durch die Fahrbeanspruchung nicht beschädigt oder undicht werden. Treibgasbehälter, Schlauchleitungen und Armaturen dürfen nicht über die Begrenzung des Fahrzeuges hinausragen.
- Flüssigphase führende Rohrleitungen und deren Ausrüstungsteile sowie Treibgasbehälter dürfen keiner unzulässigen Wärmeeinwirkung ausgesetzt werden.
Dies ist für Treibgasbehälter bzw. Rohrleitungen z. B. dann gewährleistet, wenn- der Treibgasbehälter außerhalb des Motorraumes angeordnet und nicht der Abluft durch die Motorkühlung sowie der Einwirkung der Abgasanlage ausgesetzt ist,
- der Abstand des Treibgasbehälters zur Abgasanlage und anderen heißen Teilen so gewählt wurde, dass die Temperatur des Treibgasbehälters 65°C nicht überschreitet,
- fest verlegte Rohrleitungen im Motorraum bzw. im Wärmeeinwirkungsbereich der Auspuffanlage durch geeignete Abschirmungen geschützt sind,
- nur Schlauchleitungen der Druckklasse 30 (Prüfdruck 30 bar) nach DIN 4815 Teil 4 verwendet werden,
- Schlauchleitungen
- nur außerhalb des Motorraums verwendet werden,
- nicht der Abluft durch die Motorkühlung sowie der Einwirkung der Abgasanlage ausgesetzt sind und
- mit einem ausreichenden Abstand zur Abgasanlage und anderen heißen Teilen verlegt sind.
- Das Betanken von Treibgastanks muss von außen sicher und leicht durchgeführt werden können. Hierbei sind neben geeigneter Arbeitsschutzkleidung (lange Hose, lange Ärmel) insbesondere Kälte-Schutzhandschuhe und Augen- oder Gesichtsschutz zu benutzen.
Bei der Positionierung von Treibgasflaschen sind ergonomische Erkenntnisse zu berücksichtigen, sodass der Treibgasflaschenwechsel sicher und leicht durchgeführt werden kann. - Treibgasbehälter und die zugehörigen Rohrleitungen dürfen nur dann in Gehäusen untergebracht werden, wenn die Gehäuse nicht brennbar ausgeführt sind und an ihrer tiefsten Stelle unverschließbare Öffnungen von mindestens 200 cm² freiem Querschnitt je Behälter vorhanden sind und die Gehäuse gegenüber dem Führerhaus oder dem Fahrgastraum gasdicht ausgeführt sind.
- Treibgasanlagen müssen so eingestellt werden, dass der Schadstoffgehalt in den Abgasen so niedrig wie möglich gehalten wird. Eine Minimierung der Schadstoff-Gehalte in Abgasen ergibt sich, wenn z. B. eine einwandfreie Verbrennung im Motor gewährleistet ist. Eine einwandfreie Verbrennung liegt vor, wenn der CO-Gehalt im unverdünnten Abgas 0,1 Vol.-% nicht übersteigt. Eine Minimierung der Schadstoffe kann erfahrungsgemäß bei wechselweisem Betrieb mit Benzin nicht erreicht werden. Für eine Minimierung der Schadstoffe ist es auch erforderlich, dass Luftfilter von Motoren regelmäßig auf Sauberkeit kontrolliert und ggf. ersetzt werden.
- Die Einstellvorrichtung für das Gas-Luft-Gemisch muss gegen unbeabsichtigtes Verstellen gesichert werden. Das Sichern gegen unbeabsichtigtes Verstellen kann durch Versiegeln oder Verplomben erfolgen.
- Es dürfen nur solche Treibgasanlagen verwendet werden, bei denen das plötzliche Ausströmen eines großen Flüssiggas-Volumens verhindert wird. Dies ist z. B. erfüllt, wenn unmittelbar am Entnahmeventil des Treibgasbehälters ein Rohrbruchventil angebracht wird, das auf den maximalen Gasverbrauch abgestimmt ist.
- Treibgasanlagen dürfen nicht gleichzeitig aus mehreren Treibgasbehältern versorgt werden. Besteht die Versorgungsanlage aus mehreren Treibgasbehältern, muss durch geeignete Maßnahmen, wie z. B. ein Handumschaltventil oder Elektromagnetventil, sichergestellt werden, dass ein Überströmen von Flüssiggas von einem Treibgasbehälter in den anderen verhindert ist.
- Fahrzeuge mit Treibgasanlagen dürfen nur dann in ganz oder teilweise geschlossenen Räumen betrieben werden, wenn in der Atemluft keine gefährlichen Konzentrationen gesundheitsschädlicher Abgasbestandteile entstehen können. Siehe auch
- § 54 Abs. 4 der DGUV Vorschrift 70 bzw. 71 "Fahrzeuge"
- § 21 der DGUV Vorschrift 67 bzw. 68 "Flurförderzeuge",
- TRGS 402 und 900.
Gefährliche Konzentrationen gesundheitsschädlicher Abgasbestandteile sind dann nicht anzunehmen, wenn bei Messungen die in den Technischen Regeln für Gefahrstoffe TRGS 900 "Arbeitsplatzgrenzwerte" angegebenen Werte für die einzelnen Stoffe unterschritten werden. Bei Stoffgemischen schließt die Einhaltung der Grenzwerte der einzelnen Komponenten eine Gefährdung nicht aus. Zur Vermeidung gefährlicher Konzentrationen gesundheitsschädlicher Abgasbestandteile ist eine ausreichende Be- und Entlüftung erforderlich, siehe 5.1.12 Lüftungseinrichtungen/Abgasleitungen. - Unter Erdgleiche dürfen Fahrzeuge mit Treibgasanlagen nur betrieben werden, wenn
- natürliche oder technische Lüftung die Bildung einer explosionsfähigen Atmosphäre verhindert,
- Treibgasflaschen nur über Erdgleiche gewechselt werden,
- Treibgastanks mit einer automatisch arbeitenden Füllstandsbegrenzung ausgerüstet sind,
- das Entnahmeventil des Treibgasbehälters mit einer Einrichtung versehen ist, die bei Stillstand des Motors die Gaszufuhr zuverlässig absperrt,
- Schlauchleitungen mit Einrichtungen versehen sind, die verhindern, dass bei Schlauchbeschädigungen Gas in gefahrdrohender Menge entweichen kann und
- ständige Aufsicht besteht.
- Abnehmbare Treibgasbehälter dürfen nur dann in Einstellräumen ausgewechselt werden, wenn die Bildung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre verhindert ist.
- Fahrzeuge mit Treibgasanlage sind sicher abzustellen.
Unter Abstellen wird die Außerbetriebnahme von Fahrzeugen für längere Zeit, z. B. zu Pausen oder nach Arbeitsschluss, verstanden.
Sicher abstellen beinhaltet:
- ausreichende Be- und Entlüftung im Abstellbereich,
- Abstellen nur über Erdgleiche,
- Schließen des Entnahmeventils, soweit keine selbsttätig wirkende Absperreinrichtung vorhanden ist,
- Einhalten eines Gefahrenbereiches nach Abbildung 37, in dem sich keine Kelleröffnungen und -zugänge, Gruben und ähnliche Hohlräume, Kanaleinläufe ohne Flüssigkeitsverschluss, Luft- und Lichtschächte sowie brennbares Material befinden dürfen.
5.2.8 Flüssiggasanlagen zu Brennzwecken in oder an Fahrzeugen
Flüssiggasanlagen zu Brennzwecken in oder an Fahrzeugen sowie Anhängerfahrzeugen sind z. B. Anlagen zum Kochen, Grillen, Frittieren, Heizen, Beleuchten, Kühlen und für Feldkochherde. Der Betrieb dieser Anlagen ist nur bei ausreichender Luftzufuhr und sicherer Abgasabführung erlaubt, z. B. mit geöffneten Verkaufsklappen, Fenstern, Zwangsbelüftungen oder Dachluken.
Unter Fahrzeugen sind auch Fahrzeugaufbauten zu verstehen, die nur gelegentlich verfahren werden. Baucontainer zählen nicht zu den Fahrzeugen.
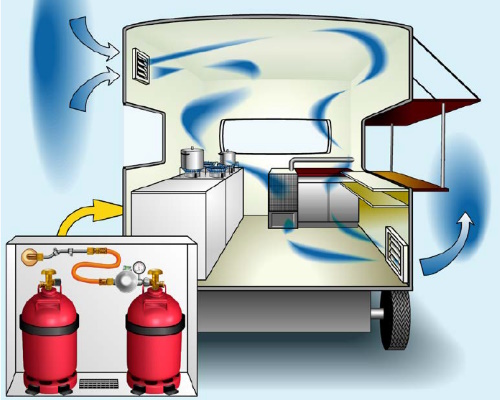
Abb. 38 Flüssiggasanlage zu Brennzwecken im Fahrzeug
- In Fahrzeugen mit Flüssiggasanlagen zu Brennzwecken darf Gas gleichzeitig aus
- maximal 4 Flüssiggasflaschen mit je ≤ 16 kg zulässigem Füllgewicht,
- maximal 2 Flüssiggasflaschen mit je > 16 kg ≤ 33 kg zulässigem Füllgewicht oder
- dauernd fest mit dem Fahrzeug verbundenen Brenngastanks bis zu je 200 Liter Fassungsvermögen
entnommen werden.
Im Brenngastank wird Flüssiggas zum Verbrennen bereitgehalten, z. B. zum Grillen, Heizen, Kochen und Kühlen in Fahrzeugen, wobei die Entnahme aus der gasförmigen Phase erfolgt.
Wenn das Fahrzeug sowohl mit Flüssiggasflasche(n) als auch mit einem Brenngastank ausgerüstet ist, muss ein handbetätigtes Umschaltventil eingebaut werden, das wahlweise die Entnahme ausschließlich aus einer der beiden Flüssiggasversorgungsquellen (Brenngastank oder Flüssiggasflasche) zulässt. - Abweichend von Absatz 1 darf bei einem Feldkochherd Gas gleichzeitig aus maximal 4 Flüssiggasflaschen mit je bis zu 33 kg zulässigem Füllgewicht entnommen werden. Unter Feldkochherden werden auch so genannte Küchenwagen von Hilfsorganisationen bzw. Feldküchen verstanden.
- Bei der Aufstellung von Flüssiggasflaschen außerhalb des Fahrzeuges dürfen höchstens 8 Flüssiggasflaschen zur gleichzeitigen Gasentnahme angeschlossen werden.
- Die Flüssiggasflaschen nach Absatz 1 dürfen in oder an Fahrzeugen nur untergebracht werden
- in von außen zugänglichen Schränken oder Kästen,
- die im Inneren zum Fahrzeug hin aus Baustoffen mit ausreichender Feuerwiderstandsfähigkeit bestehen. Die Forderung nach ausreichender Feuerwiderstandsfähigkeit ist grundsätzlich erfüllt, wenn durch eine Brandeinwirkung vom Fahrzeug aus für eine Zeit von mindestens 20 Minuten, durch die im Schrank oder Kasten eingebauten Flüssiggasflaschen keine zusätzlichen Gefährdungen ausgehen. Die Forderung nach ausreichender Feuerwiderstandsfähigkeit schließt die Durchführungen von Rohrleitungen sowie Bohrungen etc. in den Schränken oder Kästen ein.
Bei in Serie gefertigten Freizeitfahrzeugen (Wohnmobilen oder Wohnwagen), die gewerblich als Büro oder temporäre Unterkunft genutzt werden, ist die Ausführung des Flaschenkastens nach DIN EN 1949 ausreichend. - die so dicht ausgeführt sind, dass kein Flüssiggas in den Fahrzeuginnenraum gelangen kann.
- in denen sich keine Zündquellen befinden.
- die in ihrer Unterseite oder unmittelbar über der Bodenoberfläche ausreichend große Lüftungsöffnungen haben, die direkt ins Freie führen (siehe 5.1.12 Lüftungseinrichtungen/Abgasleitungen – mindestens 1 % der Bodenfläche, jedoch nicht kleiner als 100 cm² Öffnung). Die Lüftungsöffnung darf weder von innen noch von außen verdeckt werden, z. B. darf die Flüssiggasflasche nicht auf dem Lüftungsgitter stehen. oder
- die im Inneren zum Fahrzeug hin aus Baustoffen mit ausreichender Feuerwiderstandsfähigkeit bestehen. Die Forderung nach ausreichender Feuerwiderstandsfähigkeit ist grundsätzlich erfüllt, wenn durch eine Brandeinwirkung vom Fahrzeug aus für eine Zeit von mindestens 20 Minuten, durch die im Schrank oder Kasten eingebauten Flüssiggasflaschen keine zusätzlichen Gefährdungen ausgehen. Die Forderung nach ausreichender Feuerwiderstandsfähigkeit schließt die Durchführungen von Rohrleitungen sowie Bohrungen etc. in den Schränken oder Kästen ein.
- außerhalb des Fahrzeuginnenraumes.
Bei einem direkt an der Fahrzeugaußenwand befestigten Flaschenschrank muss der Flaschenschrank allseitig (einschließlich der Rückwand) aus nichtbrennbaren Werkstoffen bestehen, z. B. aus verzinktem Stahlblech. - in von außen zugänglichen Schränken oder Kästen,
- Abweichend von Absatz 4 dürfen nur eine zur Gasentnahme angeschlossene und eine bereitgehaltene Flüssiggasflasche mit einem jeweiligen zulässigen Füllgewicht ≤ 16 kg im vom Fahrzeuginnenraum aus zugänglichen Kasten untergebracht werden. Die weiteren Anforderungen des Absatzes 4 zur ausreichenden Feuerwiderstandsfähigkeit, Zündquellenfreiheit, Lüftungsöffnung im Kasten und Dichtheit des Kastens zum Fahrzeuginnenraum, sind einzuhalten. Die Dichtheit des Kastens kann gewährleistet werden, wenn ausschließlich der obere Deckel zum Einstellen und Herausnehmen der Flasche beweglich gestaltet ist, z. B. mit Scharnier.
- Flüssiggasflaschen nach den Absätzen 1 und 2 müssen fest mit dem Fahrzeug verbunden und gegen Verdrehen gesichert werden, z. B. mit Spannvorrichtungen, siehe Abbildung 38.
- Flaschenventile dürfen nur dann vom Fahrzeuginnenraum betätigt werden können, wenn
- mit diesen Fahrzeugen keine Personen befördert werden,
- sich eine vorhandene Bedienungsöffnung oberhalb des Flaschenventiles befindet und durch eine selbsttätig schließende Klappe gesichert ist.
- In Führerhäusern dürfen Flüssiggasflaschen oder Einwegbehälter (Druckgaskartuschen) weder vorhanden noch aufgestellt sein. In Führerhäusern dürfen sich keine Öffnungen zu Aufstellungsräumen von Flüssiggasflaschen oder Einwegbehältern befinden.
- Zur Versorgung der Verbrauchsanlagen in Fahrzeugen dürfen grundsätzlich nur Brenngastanks verwendet werden, bei denen gewährleistet ist, dass das Flüssiggas aus der Gasphase entnommen wird.
- In Fahrzeugen mit Brenngastanks sind diese wie folgt einzusetzen:
- Brenngastanks können wahlweise in einem Kasten im Bereich des Fahrzeugaufbaus oder unterhalb des Fahrzeugaufbaus, z. B. direkt am unterseitigen Rahmen, untergebracht werden.
- Bei einem Einbau in einem Kasten darf der Zugriff nur von außen möglich sein. Der Kasten muss zum Innern des Fahrzeuges hin aus Baustoffen mit ausreichender Feuerwiderstandsfähigkeit bestehen.
Die Forderung nach ausreichender Feuerwiderstandsfähigkeit ist grundsätzlich erfüllt, wenn durch eine Brandeinwirkung vom Fahrzeug aus für eine Zeit von mindestens 20 Minuten durch die im Kasten eingebauten Brenngastanks keine zusätzlichen Gefährdungen ausgehen. - Der Kasten muss so dicht ausgeführt sein, dass kein Flüssiggas in den Fahrzeuginnenraum gelangen kann.
- Der Kasten muss eine ausreichende Lüftungsöffnung von mindestens 100 cm² in der Unterseite oder unmittelbar über der Bodenfläche aufweisen, die direkt ins Freie führt. Im Kasten dürfen sich keine Zündquellen befinden.
- Für ein sicheres Betanken muss ein ausreichend großer Zugriffs- und Bewegungsbereich um den Füllanschluss vorhanden sein.
- Beim Betanken auftretende Gasansammlungen oder aus Sicherheitsventilen ausströmendes Gas dürfen nicht in den Fahrzeuginnenraum gelangen können.
- Lüftungsöffnungen zum Fahrzeuginnenraum dürfen nur in ausreichendem Abstand zu dem Füllanschluss oder den Lüftungsöffnungen des Kastens zur Aufnahme des Brenngastanks vorhanden sein. Als ausreichender Abstand zwischen Füllanschluss und Lüftungsöffnungen gilt 0,5 m.
- Soll die Verbrauchsanlage in einem Fahrzeug wechselweise aus Flüssiggasflaschen wie auch aus einem Brenngastank versorgt werden, so muss durch ein Umschaltventil sichergestellt werden, dass eine gleichzeitige Entnahme aus Flüssiggasflaschen und Brenngastank ausgeschlossen ist.
- Brenngastanks können wahlweise in einem Kasten im Bereich des Fahrzeugaufbaus oder unterhalb des Fahrzeugaufbaus, z. B. direkt am unterseitigen Rahmen, untergebracht werden.
- Brenngastanks sind entsprechend ihrer vorgegebenen Einbaulage für die gasförmige Entnahme einzubauen, siehe herstellerseitige Kennzeichnung. Hierbei sind die in der UN/ECE R 67-01 genannten Anforderungen zu erfüllen. Die in der UN/ECE-Regelung Nr. 67-01 festgelegte Anforderung bezüglich der Aufnahme der Beschleunigungskräfte ist erfüllt, wenn EN 12979 Anhang B entsprochen wird.
- Brenngastanks dürfen nicht überfüllt werden.
- Flüssiggasflaschen und Brenngastanks müssen so angeordnet werden, dass sie keiner unzulässigen Wärmeeinwirkung von über 40 °C ausgesetzt sind.
- Damit vorhandene Druckregeleinrichtungen bei der Dichtheitsprüfung nicht mit dem Prüfdruck beaufschlagt werden, müssen Verbrauchsanlagen, die aus Brenngastanks oder über wandmontierte (feste) Druckregeleinrichtungen versorgt werden, mit einer unmittelbar hinter der Druckregeleinrichtung installierten Absperreinrichtung mit Prüfanschluss errichtet werden.
- Werkstoffe für Rohrleitungen müssen für Fahrzeuginstallationen geeignet sein. Rohrverbindungen müssen den Fahrzeugbeanspruchungen standhalten. Dies wird z. B. durch die Verwendung der in DIN EN 1949 bzw. im DVGW Arbeitsblatt G 607 gelisteten Werkstoffe für Rohrleitungen mit den zulässigen Rohrverbindungen erreicht.
- Rohrleitungen dürfen durch die Fahrbeanspruchung nicht beschädigt oder undicht werden. Bei der Verlegung von Rohrleitungen in Radkästen ist mit Beschädigungen zu rechnen. Hinsichtlich Schlauchleitungen schließt dies ein, dass nur normgerecht fest eingebundene Schlauchanschlüsse, z. B. nach DIN EN 16436-2, verwendet werden.
- Bei kippbaren und anhebbaren Fahrzeugaufbauten muss sichergestellt werden, dass infolge Zugbelastung keine Beschädigungen an den Schlauchleitungen entstehen können. Eine derartige Maßnahme ist z. B. die Verwendung einer Schlauchabreißkupplung mit integriertem Rückschlagventil, die bei Zugbelastung die Schlauchleitung vor Beschädigung schützt sowie Gasaustritt verhindert.
- Verbrauchsanlagen müssen unverrückbar angebracht und spannungsfrei an Rohrleitungen angeschlossen werden. Hinweise für den Anschluss sind z. B. den Einbauvorschriften der Hersteller zu entnehmen.
Zu Gasgeräten und deren Einbau siehe DIN 30694-4 "Gasgeräte für Flüssiggas in Fahrzeugen; Koch-, Back-, Grill-, Kühl- und Gefriergeräte; Anforderungen und Prüfung". - Im Fahrzeuginnenraum muss im Bodenbereich eine ständig (Tag und Nacht) offene Lüftungsöffnung von mindestens 100 cm² Öffnung vorhanden sein.
- Verbrauchseinrichtungen dürfen nur mit einem Anschlusswert von mehr als 50 g/h betrieben werden, wenn die Verbrennungsluft ausschließlich aus dem Freien entnommen wird und die Abgase unmittelbar ins Freie abgeführt werden. Hinsichtlich der Führung von Abgasen ist darauf zu achten, dass die Herstellervorgaben bezüglich der Abgasführung eingehalten werden. Im Allgemeinen bedeutet dies, dass diese Abgasrohre in allen Teilen steigend verlegt sind.
Abweichend hiervon dürfen Verbrauchseinrichtungen mit einem Anschlusswert bis 50 g/h nur betrieben werden, wenn in der Nähe eine unverschließbare Lüftungsöffnung von mindestens 100 cm² Größe vorhanden ist. - Geeignete Abgasrohre sind z. B. Edelstahlabgasrohre bzw. von den Herstellern für die Gasgeräte vorgesehene Abgasleitungen.
- Abweichend von Absatz 20 dürfen Koch- und Grillgeräte mit offener Flamme oder transportable Laderaumheizungen betrieben werden, wenn ausreichend bemessene Be- und Entlüftungsöffnungen vorhanden sind. Ausreichend bemessen sind Be- und Entlüftungsöffnungen bei Verbrauchseinrichtungen mit einem Anschlusswert > 50 g/h, wenn sie je 100 g/h Anschlusswert 50 cm² groß sind, mindestens jedoch 150 cm². Die erforderliche Öffnung für Dunstschwaden wird hierdurch nicht berührt.
Hinsichtlich der Anordnung der Be- und Entlüftungsöffnungen siehe 5.1.12 Lüftungseinrichtungen/Abgasleitungen sowie lüftungstechnische Anforderungen in den Betriebsanleitungen der Gerätehersteller. - Kochgeräte dürfen nicht zur Beheizung des Fahrzeuginnenraumes benutzt werden.
- Fahrzeuge mit Flüssiggasanlagen zu Brennzwecken sind sicher abzustellen. Um abgestellte Fahrzeuge mit Flüssiggasanlagen zu Brennzwecken ist ein Gefahrenbereich einzuhalten, in dem sich keine Kelleröffnungen und -zugänge, Gruben und ähnliche Hohlräume, Kanaleinläufe ohne Flüssigkeitsverschluss, Luft- und Lichtschächte sowie brennbares Material befinden dürfen.
Sicher abstellen beinhaltet- ausreichende Be- und Entlüftung im Abstellbereich,
- Abstellen über Erdgleiche,
- Schließen des Entnahmeventils,
- Einhalten des Gefahrenbereiches, siehe auch 5.1.1 Gefahrenbereiche und Zonen.
Gegebenenfalls ist bei der Aufstellung des Fahrzeuges auf einem Volksfest nach Absprache mit dem Marktmeister oder dem Ordnungsamt der in dem Gefahrenbereich befindliche Kanaleinlauf gegen unbeabsichtigten Gaseintritt z. B. durch ein "Kanalabdichtkissen" gasdicht zu verschließen. - Vor dem Verfahren der Fahrzeuge und Befördern von Flüssiggasanlagen müssen die Absperreinrichtungen der Flüssiggasflaschen und der Verbrauchseinrichtungen geschlossen werden.
Dies gilt nicht, wenn Verbrauchseinrichtungen während der Beförderung mit Gas versorgt werden müssen und, soweit erforderlich, weitere Sicherheitsmaßnahmen getroffen sind. Behälter mit brennbaren Flüssigkeiten, z. B. Fritteusen mit heißem Fett in Fahrzeugen, müssen mit einem gut verschließbaren, dichtschließenden Deckel ausgerüstet sein, der sicherstellt, dass bei den zu erwartenden Beschleunigungen und Bremsvorgängen keine Flüssigkeit austreten kann. - Soll in einem Fahrzeug auch während der Fahrt eine Verbrauchseinrichtung betrieben werden, z. B. Kühlschrank oder Heizung, für die der Hersteller diese bestimmungsgemäße Verwendung vorgesehen hat, ist eine Einrichtung vorzusehen, die bei einem Unfall die Gaszufuhr stoppt.
5.2.9 Aufstellung von ortsfesten Verbrauchsanlagen in Räumen unter Erdgleiche
Zum Betrieb von unter Erdgleiche aufgestellten Verbrauchseinrichtungen hat die Unternehmerin oder der Unternehmer dafür zu sorgen, dass die über Erdgleiche aufgestellten Druckgasbehälter unter Beachtung der Gefahrenbereiche so aufgestellt werden, dass ausströmendes Gas nicht in Räume unter Erdgleiche gelangen kann.
Diese Forderung ist in der Regel erfüllt, wenn Druckgasbehälter unter Berücksichtigung der in 5.1.1 Gefahrenbereiche und Zonen festgelegten geometrischen Abmessungen aufgestellt sind.
Muss die Aufstellung der Druckgasbehälter an besonderen Stellen erfolgen, z. B. abfallend zu Gebäudeöffnungen, oder befinden sich Öffnungen, z. B. für Luftansaugeinrichtungen, in der Nähe von Gefahrenbereichen und Zonen, können Kombinationen von mehreren Schutzmaßnahmen erforderlich sein. Diese sind z. B. Hochführen der Luftzuführkanäle oder gasdichte Schutzmauern in Verbindung mit einer Vergrößerung des "explosionsgefährdeten Bereiches", in dem Schutzmaßnahmen gemäß 5.1.1 Gefahrenbereiche und Zonen gelten. Ortsfeste Druckgasbehälter sind nach den Festlegungen der TRBS 3146/TRGS 746 "Ortsfeste Druckanlagen für Gase" aufzustellen.
Zur Aufstellung von Flüssiggasanlagen in Räumen unter Erdgleiche siehe auch 5.1.3 Aufstellung von Flüssiggasanlagen.
Außerdem ist dafür zu sorgen, dass Verbrauchseinrichtungen unter Erdgleiche nur aufgestellt werden, wenn durch besondere Schutzmaßnahmen sichergestellt ist, dass unverbranntes Gas nicht ausströmen kann.
Die Forderung nach Durchführung besonderer Maßnahmen ist in der Regel erfüllt, wenn
- Verbrauchseinrichtungen mit Flammenüberwachungen ausgerüstet sind, die auch ein Ausströmen von unverbranntem Gas an Zünd- bzw. Wachflammenbrennern verhindern.
- Verbrauchseinrichtungen mittels fest verlegter Rohrleitungen an die Versorgungsanlage angeschlossen werden; abweichend hiervon sind Schlauchleitungen für erforderliche bewegliche Anschlüsse zulässig.
- fest verlegte Rohrleitungsverbindungen durch Schweißen, Hartlöten oder Schneidringverschraubungen bis maximal DN 32 oder als dauerhaft technisch dicht anzusehende Flanschverbindungen hergestellt werden; Schneidringverschraubungen und Flanschverbindungen müssen zugänglich sein.
- Verbrauchsanlagen so beschaffen sind, dass sie nur benutzt werden können, wenn die technische Lüftung wirksam in Betrieb ist, z. B. durch Kopplung der Verbrauchseinrichtung mit der technischen Lüftung (siehe 5.1.12 Lüftungseinrichtungen/Abgasleitungen). Wird der geforderte Luftwechsel durch technische Lüftung unterschritten oder die Verbrauchseinrichtung nicht betrieben, muss sichergestellt werden, dass die Gaszufuhr in der Rohrleitung vor Eintritt in den Raum und nicht unter Erdgleiche selbsttätig abgesperrt wird.
- bei Feuerstätten Strömungssicherungen eingesetzt werden, welche die technische Lüftung der Abgasführung nicht nachteilig beeinflussen können.
- Aufstellungsräume mit einer technischen Lüftung ausgerüstet werden, die im gesamten Aufstellungsraum einen mindestens 1,5-fachen Luftwechsel/h gewährleistet.
Eine technische Lüftung ist nicht erforderlich- bei Feuerstätten, wenn die erforderliche Verbrennungsluft dem Aufstellungsraum der Feuerstätte entnommen wird und hierdurch der geforderte 1,5-fache Luftwechsel/h gewährleistet ist,
- bei einer Verbrauchseinrichtung mit einem Anschlusswert bis 500 g/h, wenn beim Erlöschen der Flammen die Gaszufuhr in der Rohrleitung vor Eintritt in den Raum unter Erdgleiche selbsttätig abgesperrt wird oder
- wenn sichergestellt ist, dass das aus einer eventuellen Leckstelle ausströmende Gasvolumen 0,15 % des Rauminhaltes des Aufstellungsraumes nicht überschreiten kann.
Die Forderung nach besonderen Bedingungen und Maßnahmen bei der Aufstellung von Verbrauchseinrichtungen in Aufenthaltsräumen unter Erdgleiche ist erfüllt, wenn
- der Rauminhalt mindestens 20 m³ beträgt und
- über die oben genannten Maßnahmen hinaus zusätzlich ein zu öffnendes Fenster vorhanden ist, durch das beim Betrieb der Verbrauchseinrichtung die notwendige Verbrennungsluft nachströmen kann (siehe Berechnungsgrundlagen in 5.1.12 Lüftungseinrichtungen/Abgasleitungen)
Die Wirksamkeit einer technischen Lüftung kann z. B. durch Strömungsüberwachung festgestellt werden.
Eine nachteilige Beeinflussung der Abgasführung kann durch eine Sauglüftung hervorgerufen werden. Gegebenenfalls ist eine Beratung durch Lüftungsexperten oder -expertinnen erforderlich.